![]() Platzeck
gratuliert Kammersänger Peter Schreier zum 70. Geburtstag
Platzeck
gratuliert Kammersänger Peter Schreier zum 70. Geburtstag
![]() Der
Seelentonmeister
Der
Seelentonmeister
![]() Überzeugung
statt Überredung
Überzeugung
statt Überredung
![]() Dieser
Beruf ist ein Segen
Dieser
Beruf ist ein Segen
![]() Die
Kunst, in der Kunst Künstlichkeit zu vermeiden
Die
Kunst, in der Kunst Künstlichkeit zu vermeiden
![]() Die
"Provinznudel" hat noch Biss
Die
"Provinznudel" hat noch Biss
![]() Der
Hauch einer keuschen Distanz
Der
Hauch einer keuschen Distanz
![]() Der
Dresdner Tenor Peter Schreier wird 70 und hört als Sänger auf
Der
Dresdner Tenor Peter Schreier wird 70 und hört als Sänger auf
![]() Peter
Schreier 70
Peter
Schreier 70
![]() Abschied
ohne Wehmut
Abschied
ohne Wehmut
![]() Star
ohne Allüren
Star
ohne Allüren
![]() Stimmgewaltiger
Grenzgänger
Stimmgewaltiger
Grenzgänger
![]() Peter
Schreier führt jetzt ein Leben ohne Stress
Peter
Schreier führt jetzt ein Leben ohne Stress
![]() Schreiers
"Schwanengesang"
Schreiers
"Schwanengesang"
![]() Peter
Schreier kündigt Karriereende an
Peter
Schreier kündigt Karriereende an
![]() Peter
Schreier mit Sächsischem Mozartpreis für Lebenswerk geehrt
Peter
Schreier mit Sächsischem Mozartpreis für Lebenswerk geehrt
![]() "Die
Leute werden verheizt“
"Die
Leute werden verheizt“
![]() Russischer
Offizier spielte auf dem Flügel
Russischer
Offizier spielte auf dem Flügel
![]() Von
Bach kann die Kirche lernen
Von
Bach kann die Kirche lernen
![]() "Japaner
und Deutsche sind gewissermaßen ähnlich"
"Japaner
und Deutsche sind gewissermaßen ähnlich"
![]() Peter
Schreier
Peter
Schreier
![]() Mehr 2005 Artikel / More 2005 Articles
Mehr 2005 Artikel / More 2005 Articles
| 2017-2020 | 2013-2016 | 2010-2012 | 2007 - 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | < 2002 |
Land
Brandenburg 29.07.2005
Platzeck gratuliert
Kammersänger Peter Schreier zum 70. Geburtstag
Postdam. Ministerpräsident
Matthias Platzeck hat Professor Peter Schreier zum 70. Geburtstag gratuliert
und die außergewöhnliche Begabung des Kammersängers gewürdigt.
In einem Glückwunschschreiben an den Jubilar betonte Platzeck, Schreier
habe über Jahrzehnte ein großes Publikum mit seiner „unvergleichlich
warmen Stimme und einer hohen Musikalität“ begeistert. Schreiers
Interpretationen von Mozart und Schubert hätten auch die Gewissheit
gegeben, dass „Musik als universeller Botschafter alle Grenzen und
Ideologien überwindet“, unterstrich der brandenburgische Ministerpräsident.
Platzeck äußerte in dem Schreiben zugleich sein Bedauern darüber, dass sich Schreier so früh von den großen Opernbühnen zurückzogen habe. Der brandenburgische Regierungschef dankte dem Sänger für „viele unvergessliche Stunden“ und wünschte dem Jubilar für die kommenden Jahre alles Gute sowie Gesundheit.
Der
Tagesspiegel 29.07.2005
Der Seelentonmeister
Zum 70.
Geburtstag des Tenors Peter Schreier
Die Stimme kommt aus der sächsischen Kantoreitradition. Gemäß dem Bachtitel „Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen“ wurzelt dort auch das Wunder Peter Schreier, das von Dresden aus in die Welt strahlt. Der Meißener Kantorensohn, der durch die leistungsorientierte Schule des Dresdner Kreuzchores gegangen ist, sieht sich alsbald von einem japanischen Peter-Schreier-Fan-Club in Tokio umringt. Aus dem einstigen Altisten ist ein lyrischer Tenor geworden. Und es gehört zu seinem frühen Ruhm, dass er von Karl Böhm bei einer „Giovanni“-Produktion in Wien als „Herr Schreier“ vorgeführt wird, „ein Sänger, der sich diesen Namen wirklich leisten kann.“
Die DDR hat den Ausnahme-Sänger zum Vorzeigekünstler gemacht. Das bedeutete damals, Reisefreiheit zu genießen und gelegentlich mit Politikern wie Honecker musikalischen Smalltalk über Schuberts Lieder zu halten. Nationalpreis hin, Verdienstorden her – Schreier schmückt Akademien in Ost und West. Die Berliner Staatsoper ist zu seinem Stammhaus geworden. Heimisch fühlt er sich auch in Wien und bei den Salzburger Festspielen, wo es um ihn in den Siebzigern ein legendäres „Così“-Ensemble gab: mit Gundula Janowitz, Brigitte Fassbaender, Reri Grist, Hermann Prey und Dietrich Fischer-Dieskau. Das spezifische Timbre aus Jugend und Weisheit, der Typus des strebenden Sängers und die seit der Kindheit als Kreuzianer erworbene Stilsicherheit sind seiner Bühnenpersönlichkeit erhalten geblieben. Im Jahr 2000 singt er an der Lindenoper zum letzten Mal Mozart: Taminos Abschied und Zauber.
Was Peter Schreier als sein Credo verteidigt, hat mit seiner Vertiefung in das „Zwielicht“ romantischer Liedschule zu tun: „Bei mir muss der Ton eine seelische Komponente haben.“ Obwohl ihn eine Aura des Gelehrten umgibt, bleibt der Bach-, Mozart-, Schubert- und Schumann-Sänger wie der auch in der Oper versierte Dirigent im Innersten Romantiker. So geht er mit zeitgenössischer Musik sparsamer um als sein Freund Theo Adam – und macht vor allem eine Ausnahme: Paul Dessau.
Am „Ziel aller Wünsche“, der Leipziger Thomaskirche, singt Schreier 1961 zum ersten Mal den Evangelisten in der Matthäuspassion von Bach. Sein Name ist nachgerade zum Synonym für die Partie geworden. Und Herbert von Karajan entdeckte in dem Bachsänger seinen Wagnersänger: Die Art, in der Schreier den Evangelisten interpretiere, müsse auch für den Loge im „Rheingold“ geeignet sein.
An den David der „Meistersinger“
ist er indessen schon früher in Dresden herangegangen. Die Schulweisheiten
des Lehrbuben trägt er in der Karajan-Einspielung mit lautmalerischen
Finessen und viel Kantabilität vor: „jed’ Zierat fest nach
des Meisters Spur“. Dabei ist zu bestaunen, wie eng Peter Schreiers
David und Evangelist musikalisch miteinander verwandt sind: Unverwechselbar
in Wort und Ton. Heute feiert der Sänger seinen 70. Geburtstag. S.M.
Kölner
Stadt-Anzeiger 29.07.2005
Überzeugung statt Überredung
Vom Sängerknaben zum Opernsänger: Der
Tenor Peter Schreier wird heute 70 Jahre alt.
Es gibt nur wenige Sänger, die den zerstörerischen
Anfechtungen von Karriere, Markt und Ruhm so standhaft getrotzt haben wie
der im sächsischen Gauernitz (bei Meißen) aufgewachsene Tenor
Peter Schreier. Sein künstlerisches Leben ist das Musterbeispiel einer
stetigen, behutsamen und kontrollierten Entwicklung vom Sängerknaben
im Dresdner Kreuzchor zum Opern- und Liedinterpreten des lyrischen Fachs,
ein Musterbeispiel, das Abweichungen vom Pfad der stimmlichen Vernunft,
musikalischen Neigung und künstlerischen Redlichkeit nur als gleichsam
verrenkte Experimente gestattete: Für heldisch angehauchte Partien
wie Florestan, Max oder Palestrina etwa war Schreiers heller, leichter Tenor
in Volumen und Durchschlagskraft nur wenig geeignet. Gestalterische Intelligenz
und stimmliche Ökonomie waren freilich auch hier zu bestaunen.
Das Staunen war bei Erlebnis und Kenntnisnahme von Peter Schreiers Kunst vermutlich immer die primäre Empfindung. Er war kein Sänger, der überrumpelte und überrollte, er war ein Künstler, der nicht überreden, sondern überzeugen wollte. Gewiss besaß Schreiers Stimme in ihrer Jugend manchen Ansatz von verführerischem Glanz, eine latente Sinnlichkeit. Doch verließen den Sänger die Lockmittel tenoraler Rattenfängerei schon früh, zunehmend setzte er auf deutliche, nachdrückliche, primär zerebral bestimmte Auseinandersetzung mit den Texten und Weisen. Seine Interpretationen mochten sogar pädagogisch streng und gefühlsmäßig eng erscheinen, und wer in dieser Reduktion auf das Geradlinige und Einfache, auf das aber letzlich denn doch Wesentliche mehr eine Not als eine Tugend sah, konnte mit Geringschätzungen wie „brillenbewehrter Professor“ schnell irren.
Die Freuden, die Peter Schreier mit seiner uneitlen, gedankentiefen Annäherung an die Musik geschenkt hat, betrafen in Sonderheit die Opern von Mozart, die Oratorien und Kantaten von Bach und das gesamte Deutsche Kunstlied - und dies, da Schreier heute in aller Rüstigkeit seinen Siebziger feiern kann, seit nunmehr fast fünfzig Jahren. Auch in Köln wurde Schreier oft gefeiert, beim Schubert-Lied oder als Bach-Evangelist, und gerade hier, in dieser einerseits intimen, andererseits durchgeistigten Kunst schien es manchmal, als wolle Schreier, dieser Exponent einer noblen Verhaltenheit, etwas riskieren, seine Grenzen sprengen, emotional ausbrechen.
Mit
Bach und Schubert wird Peter Schreier auch unterwegs sein, wenn er im Spätsommer
seinen Abschied („Ende 2005 ist Schluss!“) vom aktiven Musizieren
nehmen will. Dem Verehrer seiner Kunst bleiben viele schöne Erinnerungen,
abzurufen auf Hunderten von Schallplatten, nachzulesen in der Autobiografie
„Im Rückspiegel“. Aber vielleicht überlegt er sich's
noch einmal. G.B.
Süddeutsche
Zeitung 29.07.2005
Dieser Beruf ist ein
Segen
Ein Gespräch
mit dem Tenor Peter Schreier, der heute 70 wird
SZ: Herr Schreier, wie wichtig war der Beruf Ihres Vaters, der ja Kantor
war, für Ihre Karriere?
Schreier: Enorm wichtig.
Mein Vater hatte den Ehrgeiz, seine beiden Söhne in der Musik zu befestigen
wozu es gar keiner Überredungskunst bedurfte. Einmal wöchentlich
wurden wir mit Kammermusik gefüttert, das gehörte zum Alltag wie
das Bad am Sonntagabend in der Zinkwanne. Dazu kam das Chaos bei Kriegsende,
vielleicht sah man da in der Musik die einzige Möglichkeit, aus diesem
Inferno herauszufinden.
SZ: Sie sind 1945 in den Kreuzchor eingetreten.
Dresden lag in Schutt und Asche. Reichte die Kraft der Musik aus, um mit
dem Elend zurechtzukommen?
Schreier: Kinder haben die Gabe, von vorne
anfangen zu können. Ich kam aus einem Dorf in der Nähe Dresdens
und ich wusste nur, jetzt geht irgentwas los. Ich war nicht in der Kreuzschule,
die war abgebrannt, sondern in Kellerräumen am Rande Dresdens, dort
habe ich mich im Chor derart an das neue Leben gewöhnt, dass ich gar
nicht mehr nach Hause wollte. So wurde eine sehr enge Gemeinschaft geschaffen.
Meine besten Freunde heute sind die damaligen Mitglieder des Chores.
SZ: Sänger geworden zu
sein: was bedeutet das für Sie im Rückblick?
Schreier: Zunächst: Es
ist ein Glück, eine Stimme bekommen zu haben, mit der man sich ausdrücken
kann, sogar Freude vermitteln kann. Ein Lehrer muss strafen, ein Sänger
darf die Menschen mit aufbauenden Elementen versorgen. Insofern ist dieser
Beruf ein Segen.
SZ: Was fasziniert einen Sänger,
dem es gestattet war, in der ganzen Welt zu singen, am Dirigieren? Ist es
der Canettischen Hauch von Macht?
Schreier: Überhaupt nicht.
Es ist das Zurück zur Gemeinschaft, das Glück, als Gleicher unter
Gleichen zu musizieren. Ich will doch nicht anderen Musikern meinen Willen
aufzwingen - obwohl man es teilweise machen muss. Deswegen habe ich mir Orchester ausgesucht, die meine Art zu dirigieren explizit wollen.
SZ: Ist Musik auf dem Weg elitär zu
werden?
Schreier: Nein. Schon die Veranstalter
sind ja daran interessiert, dass ein Pulbikum da ist. Allein deswegen kann
man klassische Musik nicht allzu elitär handhaben, sprich: Die Eintrittspreise
müssen moderat bleiben. Doch es gibt die Tendenz zum Elitären,
die ich aber schon vor Jahrzenten in Salzburg erlebt habe. Viele waren nur
da, um gesehen zu werden und um Karajan zu erleben.
SZ: Als Künstler hätten
Sie doch sagen müssen: Für diese Leute singe ich nicht.
Schreier: Nein. Das Publikum
bei meinen Liederabenden im Mozarteum war ein ganz anderes; es war aufmerksam,
sachkundig, engagiert, sehr interessiert.
SZ: Liegt das womöglich
daran, dass die Kunstform Lied gegenüber der Kunstform Oper die verdichtete
ist?
Schreier: Ja. Das Lied ist
die Sublimierung hin auf eine bestimmte Intimität.
SZ: Welche Konzeption ist
bei Schuberts Liedern die sinnvollere: die dramatische oder die lyrische?
Schreier: Beides ist darin enthalten. Schubert-Lieder kann man nie nur mit
schöner Stimme und sauberer Diktion singen. Es muss dahinter ein Mensch
stehen, der zu überzeugen vermag. Das Publikum nimmt einem Sänger
nur schön gesungene Lieder nicht ab. Manche große Opernsänger
verstehen das falsch, wenn sie glauben, man müsse Lieder nur instrumental
singen. Es ist zwar ein kontrollierteres Singen notwendig, aber vom Ausdruck
her unbedingt expressiv.
SZ: Haben Sie je das Tier Angst im Rücken
gespürt?
Schreier: Natürlich.
Vor allem mit zunehmendem Alter. Denn das Publikum orientiert sich immer
noch an der Leistung, die ich vor zwantig Jahren gebracht habe. Deswegen
höre ich auch in diesem Jahr mit dem Singen auf.
SZ: Werden Sie Ihren Abschied
in Ihrer Heimatstadt Dresden geben?
Schreier: Nein. Hier werde
ich letztmalig zur Einweihung der Frauenkirche singen. Von Wien verabschiede
ich mich im September mit drei Liederabenden, und zum letzten Mal singe
ich in Prag, am vierten Advent, mit dem Weihnachtsoratorium von Bach. J.O.
Frankfurter
Allgemeine Zeitung 29.07.2005
Die Kunst, in der Kunst Künstlichkeit zu vermeiden
Ein Meistersinger, dem Sternstunden mit Schubert, Schumann und Bach
glückten: Zum siebzigsten Geburtstag des lyrischen Tenors und Dirigenten
Peter Schreier
Der in Meißen geborene Kantorensohn Peter Schreier wurde mit zehn Jahren in den von Rudolf Mauersberger geleiteten Dresdner Kreuzchor aufgenommen. Schon früh wurden ihm die Altpartien in Bachs Johannes-Passion und in der h-Moll-Messe übertragen. Die Stimme des sechzehnjährigen Knaben-Alt ist auf einigen Aufnahmen zu hören. Mit zwanzig Jahren sang er zum ersten Mal den Evangelisten in Bachs Matthäus-Passion. Die ersten Opernerfahrungen sammelte er als Mitglied des Dresdner Opernstudios in Partien wie Paolino in Cimarosas "Il Matrimonio Segreto" und Belmonte in Mozarts "Entführung", den er später unter Karl Böhm aufgenommen hat.
Im August 1959 wurde er Mitglied der Dresdner Staatsoper, zwei Jahre später auch der Berliner Staatsoper. Über die ersten Schritte im Rampenlicht berichtete er, daß es seinen Lehrer Erhard Fischer beim dramatischen Unterricht einige Mühe kostete, "aus dem schauspielerisch nicht so anstelligen Sänger einiges an gestischem und mimischem Ausdruck herauszuholen". Von seinem Naturell und seinem Temperament her ist er ein lyrischer und kein dramatischer Sänger.
Diese innere Gestimmtheit findet ihren Widerhall im Klang der Stimme sowohl wie im Vortrag. Als er 1967 in Salzburg in der Rolle des Tamino - anstelle des zunächst vorgesehenen Fritz Wunderlich - sang, begegnete ihm der Einwand, daß ihm die Kreuzchor-Vergangenheit nachhänge und sein Anima-candida-Timbre nicht weit von dem eines edlen Vikars liege. Daß er seinem Kollegen im canto di bravura durchaus ebenbürtig ist, bewies er in Belmontes Es-Dur-Arie "Ich baue ganz auf deine Stärke"; und schlüge bei seinem Idomeneo - "Fuor del mar" in der virtuosen ersten Fassung - oder seinem Tito nicht immer der Ton eines "Caro Sassone" durch, würde er als Virtuose höher geschätzt.
Das Problem seiner italienischen Mozart-Aufnahmen liegt, insbesondere in den Rezitativen, in der nicht idiomatischen Lautung der Vokale. Es ist, als würde durch deren enggeschlossene Bildung der in den Vokalen liegende Affekt verkapselt. Der Drang oder Zwang, sich expressiv zu entfalten, führte in der "Freischütz"-Aufnahme unter Carlos Kleiber zu rhetorischen Übertreibungen. Eine Glanzleistung bot er als David in der "Meistersinger"-Aufnahme unter Herbert von Karajan. In der Szene zwischen dem Lehrbuben und Walter erweist er sich - subtil artikulierend, eloquent phrasierend, klangmalerisch suggestiv agierend - als Meistersinger, der, dem Sinn dieser Musik über Musik gerecht werdend, eine Lehrstunde des Wagner-Gesangs erteilt.
Als Liedersänger hat sich Peter Schreier auf bewunderungswürdige Weise entwickelt. Seine ersten Aufnahmen sind zu Beginn der siebziger Jahre für VEB Deutsche Schallplatten entstanden. Mit Werner Olbertz hat er Lieder von Prokofjew, Hindemith und Mendelssohn sowie jeweils drei Platten mit Liedern von Beethoven und Schubert aufgenommen, sodann drei Schumann-Einspielungen mit Norman Shetler. Auch wenn es Einwände gegen die schmale Farbpalette gab, stehen schon die frühen Aufnahmen auf höchstem Niveau. Schreier erweckt den Eindruck einer kunstlosen Natürlichkeit: jener Kunst, die die Kunst verbirgt. Damit entspricht er einer Forderung der frühromantischen Ästhetik, Kunst als absichtslose Natur erscheinen zu lassen. Im letzten Lied von Beethovens "An die ferne Geliebte" etwa gelingt ihm ein magischer Moment. In der Molto-adagio-Phrase "Und sein letzter Strahl verglühet/ Hinter jener Bergeshöhe" beschwört er Ruhe und den Stillstand der Zeit.
Schreier hat den "Liederkreis" op.39 nach Eichendorff, die beiden Heine-Zyklen und verschiedene andere Lieder noch einmal im Jahre 1988 aufgenommen, nun mit Christoph Eschenbach als Partner. Enthusiastisches Lob bekam er von dem englischen Pianisten Graham Johnson, dem Initiator und Pianisten der von Hyperion herausgebrachten Gesamtaufnahme aller Schubert-Lieder. Dem Schubert-Sänger gebührt ein Ausnahmeplatz unter den Tenören. Exzeptionell gelungen ist seine Aufnahme der "Winterreise", die er zur Wiedereröffnung der Dresdner Staatsoper, mit Swjatoslaw Richter als Partner, sang. "Die schöne Müllerin" hat er fünfmal mit Begleitern auf verschiedenen Instrumenten aufgenommen. Auf den Pianisten Walter Olbertz folgte zunächst der Gitarrist Werner Ragossnig, diesem der auf einem Hammerklavier spielende Steven Zehr. 1980 entstand auf Initiative der Stiftung Volkswagenwerk eine kaum bekanntgewordene Aufnahme auf der Grundlage der vom Verleger Anton Diabelli gedruckten Ausgabe mit den Verzierungen, die Johann Michael Vogl, der Sänger-Freund des Komponisten, "zum allgemeinen Entzücken vorgetragen" hatte. Da das "Verbannen der Verzierungen" , wie Friedrich Rochlitz damals in der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" anmerkte, zu einer gewissen Steifheit, Trockenheit und Reizlosigkeit führe, fügte Vogl, insbesondere bei Fermaten und an Phrasenenden, Doppelschläge, Mordente, Tremoli, Arpeggien, Triller und andere Ornamente ein, die den Affekt oder den Wortsinn intensivierten. Schreier gelang es, den "notierten Improvisationen" ein hohes Maß an Spontaneität zurückzugeben. Mit dem famosen ungarischen Pianisten Andras Schiff hat Schreier, stimmlich schier alterslos, seit Ende der achtziger Jahre die beiden Zyklen wie den sogenannten Schwanengesang aufgenommen: Sternstunden des Schubert-Gesangs.
Wenigstens kurz ist auf den Bach-Sänger hinzuweisen, auf den Evangelisten, den er in drei Aufnahmen der Matthäus-Passion gesungen hat; eine hat er selber dirigiert. Es war kein Zugeständnis an einen Star. Seiner Dirigierbegabung hatte er schon die Stellung des Chorpräfekten bei den Kruzianern verdankt, und zu seiner Ausbildung an der Hochschule gehörte auch ein Dirigierstudium. Später beeindruckte er Herbert von Karajan so sehr, daß dieser ihn zu einem Konzert mit den Berliner Philharmonikern einlud. Peter Schreier, der heute sein siebtes Lebensjahrzehnt vollendet, hat jüngst erklärt, daß er zum Jahresende als Sänger abtreten will. J.K.
Freie Presse 29.07.2005
Die „Provinznudel“
hat noch Biss
Der Startenor
und Dirigent Peter Schreier wird heute 70 und singt zur Weihe der Dresdner
Frauenkirche
Wenn heute Peter Schreier
mit Familie und Freunden auf einem Elbdampfer gen Tschechien schippert,
bleibt er auch zu seinem 70. Geburtstag mit dem geliebten Dresden verbunden.
Er ist „eine Provinznudel“, wie er sich selbst lachend charakterisiert.
Eine Provinznudel, die schon zu DDR-Zeiten als Startenor auf den größten
Bühnen der Welt auch einem breiten Publikum die Sangeskunst schmackhaft
machte, denn als „Vorzeige-Künstler“ genoss Schreier weitgehend
Reisefreiheit. Und die Provinznudel hat noch immer künstlerischen Biss:
Zuletzt feierte das Publikum zur Eröffnung des Sächsischen Mozartfestes
den bescheidenen Weltstar als Dirigenten von Mozarts „Messias“-Bearbeitung.
Das war am 7. Mai in der Chemnitzer Kreuzkirche, und Schreier dirigierte,
als müsse er sich den Mozartpreis der Sächsischen Mozart-Gesellschaft,
den er an diesem Abend erhielt, erst noch verdienen. Für die Dienste
zur Mozartpflege und Nachwuchsarbeit empfing der bereits hoch Dekorierte
die Auszeichnung und bekannte, wie glücklich er sei, weil sie den Namen
Mozarts trage. Denn Mozart verehrt er, die Rolle des schmucken Prinzen Tamino
aus der „Zauberflöte“ machte ihn weltberühmt. 1967
debütierte er darin bei den Salzburger Festspielen. (....) D.G.
::
Zu Artikel 2005 - 2 / To articles 2005 - 2
Merkur 29.07.2005
Der Hauch einer keuschen
Distanz
Zum 70. Geburtstag
des weltberühmten Mozart-Tenors Peter Schreier
Vor ein paar Monaten,
am Karfreitag in der Münchner Philharmonie, hat er noch einmal demonstriert,
was seinen Evangelisten in Bachs Matthäuspassion so einzigartig macht:
die durchgängige Textverständlichkeit, die finessenreiche Rhetorik,
eine unnachahmliche Stimmführung, die sich zwischen Deklamation und
Singen bewegt, das Verbinden von intelligenter Reflexion und lebhafter Anteilnahme
und, vielleicht das Wichtigste, eine Frische des Vortrags, die dem Zuhörer
das Gefühl gibt, hier erlebe der Evangelist das Passionsgeschehen tatsächlich
zum ersten Mal. Und das, obwohl Peter Schreier die Partie nach eigenen Angaben
"mehrere Hundert Mal" gesungen hat.
Platz im Sänger-Olymp
Auch wenn Schreier heute seinen 70. Geburtstag feiert, so ist er noch vokal
aktiv. Dies meist in der Doppelfunktion als dirigierender Evangelist, die
er aber lediglich bis Jahresende ausüben wird. Dann, nach einer finalen
Serie von Weihnachtsoratorien, will einer der bekanntesten Tenöre des
20. Jahrhunderts verstummen, um sich "nur" noch dem Dirigieren
zu widmen.
Den ewigen Platz im
Sänger-Olymp sichert Peter Schreier neben seinen Schubert-Liedern vor
allem die Interpretation Bach'scher Musik. Eine Musik, in die der gebürtige
Meißener durch die Mitgliedschaft im Dresdner Kreuzchor gleichsam
hineingewachsen ist. Schreier war dort zunächst Knaben-Alt, später
Tenor und nach dem Abitur auch Stimmbildner. (....)
Der internationale
Durchbruch erfolgte 1967 als Tamino in der Salzburger "Zauberflöte",
in einem Fach also, das Schreier einen Titel sicherte: Mozart-Tenor. Die
Partien dieses Komponisten wurden zu seiner Domäne, das sehr helle,
obertonreiche und biegsame Organ gab den Interpretationen stets etwas Kultiviertes,
aber auch den Hauch einer keuschen Distanz. Später, als die Stimme
sich weitete und nachdunkelte, wagte sich Schreier unter anderem an Pfitzners
"Palestrina" sowie an Wagners David ("Meistersinger")
und den Loge ("Rheingold"). Besonders der Loge, den er als intellektuellen
Zyniker sang und spielte, überraschte, galt Schreier doch sonst als
zurückhaltender, fast neutraler Darsteller.
Als Dirigent fühlt
sich Schreier der dramatischen, klangsatten Leipziger Tradition verpflichtet,
wurde aber maßgeblich von Nikolaus Harnoncourts Barockrhetorik beeinflusst.
Oft trat der Sachse in München auf: an der Staatsoper in seinen Glanzrollen,
auf dem Konzertpodium meist mit dem Münchener Bach-Chor, dem er auch
den neuen Chef Hansjörg Albrecht vermittelte. Und mit diesem Ensemble
wird Peter Schreier demnächst noch einmal das Weihnachtsoratorium einspielen:
das wohl letzte Zeugnis seiner Bach-Interpretation, die mindestens für
die nächsten Jahre unerreichbar bleiben wird. Denn Nachahmer mag es
geben, einen Nachfolger nicht. M.T.

thumbnail ![]()
Sächsische
Zeitung 29.07.2005
Der Dresdner
Tenor Peter Schreier wird 70 und hört als Sänger auf.
Als Dirigent wird er der Musik weiterhin dienen
„Ich staune selbst, die zeitliche Grenze eines guten Sängers um 20 Jahre überschritten zu haben – doch nun ist Schluss, bevor die Kraft nachlässt“, sagt der Dresdner Tenor Peter Schreier. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, von der Bühne Abschied zu nehmen. Sechs Jahrzehnte hatte er als Darsteller (bis 2000) und als Liedinterpret vor allem mit Mozart-Werken weltweit von Salzburg bis New York triumphieren können. Nun will er sich dirigierend dem widmen, was seine Karriere trotz allem Ehrgeiz seit der Kruzianer-Zeit geprägt hat: „Ich habe nur der Musik zu dienen, keinen Eitelkeiten zu frönen.“ Dazu will er künftig vor allem Bach und Mozart aufführen – mit Dresdner Kollegen wie Olaf Bär und Andreas Scheibner arbeiten, „deren Zuverlässigkeit und Qualität ich schätze“.
Letztmals sängerisch ist Schreier hier zu Lande zur Weihe der Frauenkirche zu erleben: zum Festgottesdienst am 30. Oktober und zum Konzert am 1. November.
Die
Welt 29.07.2005
Peter Schreier
70
Glückwunsch
Er hat die internationalste
und reichste Karriere eines deutschen Tenors seit dem jähen Tod Fritz
Wunderlichs gemacht, aber wenn er in Italienisch sang, dann erfuhr man immer,
wo er herkam. Denn ob Peter Schreier in Mozarts "Così fan tutte"
Ferrandos "Un aura amorosa" anstimmte oder in "Don Giovanni"
Ottavios "Il mio tesoro" - man hörte immer ein leichtes Sächsisch
durch, ein dezentes Näseln: keinen Latin Lover, sondern einen gewesenen
Kruzianer.
Doch das ist eigentlich schon alles, was man an Kritik an diesem großartigen, ehrlichen und ernsthaften Sänger üben kann. Andere hätte sich ob solch eher zurückhaltenden Bühnentemperaments von der Oper ferngehalten. Peter Schreier fand es eine Aufgabe, an der er wachsen konnte. Und ob er Ende der sechziger Jahre an seinem Stammhaus, der Berliner Lindenoper, in Ruth Berghaus' noch heute gespielter "Barbier von Sevilla"-Inszenierung als Graf Almavia dabei war, oder als eine seiner letzten Bühnenrollen einen abgefeimt wuseligen "Rheingold"-Loge (in der Maske Richard Wagners) in sein Repertoire aufnahm, es gelang ihm glänzend. (.....)
Peter Schreier ist ein universeller, aber auch ein sehr deutscher Sänger. Das sei in einer immer gleichmacherisch-globaleren Zeit unbedingt als Tugend verstanden. Als einer der letzten verkörpert er jenes positive Deutschtum in der Musik, zu dem in einer weniger von den Wunden der Geschichte geprägten Zeit die Welt sehnsuchtsvoll blickte. Dieser innerliche, ganz auf seine Kunst konzentrierte Moment hat ihn auch so unbeschadet von politischer Vereinnahmung als einem der prominentesten Kunstschaffenden und international lukrativsten Devisenbringern der DDR Kariere machen lassen.
Noch im Studio der Dresdner
Staatsoper engagiert, debütierte Peter Schreier 1959 als erster "Fidelio"-Gefangener.
Er wurde einer der bedeutendsten Mozart-Tenöre, bei den berühmten
Festivals und an allen großen Opernhäusern. Erst 2000 sang er,
mit weitgehend intakter, Schmelz mit Reife wettmachender Stimme seinen letzten
Tamino. Doch neben dem Konzertfach galt seine ganze Liebe dem Lied. (....)
Dresdner
Neueste Nachrichten 28.07.2005
Abschied ohne Wehmut
Der
Dresdner Kammersänger Peter Schreier feiert heute seinen 70. Geburtstag.
Mit dem Künstler, der auf eine beeindruckende, glanzvolle Laufbahn
auch als Dirigent zurückblicken kann, sprach Kerstin Leiße.
Frage: Alle Auftritte, die Sie als Sänger in diesem Jahr hatten und
noch haben, tragen auch die Überschrift "Abschied". Denn
Sie haben erklärt, im Jahr Ihres 70. Geburtstages zumindest als Sänger
von den Podien abzutreten. Warum zu diesem Zeitpunkt?
Peter
Schreier: Der 70. Geburtstag ist der richtige Moment. Auch wenn ich von vielen Seiten
gedrängt werde, noch weiterzumachen. Wenn die körperliche Spannkraft
nachlässt, kann man auch nicht mehr das machen, was man will. Die Musikfreunde
sollen mich in guter Erinnerung behalten und nicht denken, Gott, warum singt
er noch.
Ihre
Schubert'sche "Winterreise" zu den diesjährigen Musikfestspielen
- mit Camillo Radicke am Klavier - bleibt als ein besonders denkwürdiger
Abend in Erinnerung. Haben Sie dabei auch daran gedacht, dass es Ihr letzter
Liederabend in Dresden sein würde?
Das geschieht
im Unterbewusstsein. Ich bin nicht mit der Einstellung einer letzten Aufführung
in Dresden in diesen Liederabend gegangen. Natürlich sind für
mich alle Liederabende schon seit zwei Jahren mit der Hypothek befrachtet,
dass man das nicht mehr lange macht. Aber zugleich habe ich mehr Mut, mich
aufs Wesentlichste zu konzentrieren. Dass ich aus dem Geist des Stückes
heraus singe und die Freiheit habe, das auszudrücken, was ich empfinde.
Da spielen technische Fragen keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass ich den
Hörer erreiche. Und der Dresdner Abend mit Camillo Radicke war unglaublich:Er
ist ein Begleiter im besten Sinne, denn er hört und gestaltet mit und
bietet manchmal auch für mich überraschende Momente.
Sie
schreiben in Ihren als Buch veröffentlichten Erinnerungen, man könne
in der "Winterreise" nur dann den richtigen Ton treffen, "wenn
man schon einen Blick hinter das Leben getan hat..."
Ein Sänger
muss gewissermaßen die Stimmung erzeugen, die dieser Wanderer auf
seinem Weg erlebt. Das heißt, man muss auch selber empfinden können,
wie solch einem Menschen zumute ist. Das ist mir in meinen jungen Jahren
eigentlich egal gewesen, eine solche pessimistische Sicht habe ich damals
nicht gekannt. Ich bin von meiner ganzen Veranlagung her kein Mensch, der
ständig mit Todesahnung oder -sehnsucht umgegangen ist. Heute begreife
ich das besser, da ich dem Lebensende viel näher bin als vor fünfzig
Jahren.
Verschmilzt
also Peter Schreier gewissermaßen jetzt ein bisschen mit dem Wanderer
der "Winterreise"?
Könnte man
sagen. Aber nicht so sehr in der Resignation, es bleibt für mich immer
noch eine Hoffnung. Aber meine Gefühle sind ausgereifter.
Welchen
Liederzyklus würden Sie nennen, um sich selbst am besten zu charakterisieren?
"Die schöne
Müllerin" von Franz Schubert.
Sie
verausgaben sich in Ihren Liederabenden so sehr, dass Ihnen am Ende auch
eine gewisse Erschöpfung anzumerken ist. Fürderhin werden Sie
"nur" noch dirigieren, ist das weniger anstrengend?
Ja, weil ja die
anderen für mich arbeiten (lacht). Nein, beim Dirigieren liegt für
mich die Anstrengung vornehmlich in der Probenarbeit.
Welche
Werke werden Sie vom Dirigentpult aus musizieren?
Quer durch das
Repertoire, das ich selbst gesungen habe. Zum Beispiel "Die Jahreszeiten",
viel Mozart im nächsten Jahr und vielleicht auch wieder mal Bachs Passionen.
Aber dann werde ich nicht mehr den Evangelisten singen. Das wird mir wahrscheinlich
schwerfallen, denn dann kommen die Erinnerungen.
Wird
es ein anderer Tenor als Evangelist schwer mit Ihnen als Dirigent haben?
Nein, so bin ich
ja nun auch nicht. Aber vielleicht finde ich auch einmal einen Sänger,
der nach meinen Vorstellungen singt. Man ist immer gewillt, das zu vermitteln,
was man selbst als gut erachtet.
Und
wo werden Sie am Dirigentenpult stehen?
Zum Beispiel in
Zürich, in der Dresdner Frauenkirche und bei der Dresdner Philharmonie,
in Genua, Mailand, Prag, Hamburg...
Könnte
man Mozart und Bach als Ihre musikalischen Hausgötter bezeichnen?
Ja, und dann gehört
noch Schubert dazu und auch Schumann...
Welche
Oper haben Sie am liebsten gesungen?
Mozarts "Cosi
fan tutte".
Warum?
Wegen des Farbenreichtums,
der vielen Möglichkeiten, die der Ferrando in der Darstellung hat.
Also
nicht der Tamino in der "Zauberflöte"?
Nein, das ist
eher eine etwas einseitige Angelegenheit, auch der Ottavio im "Don
Giovanni". Der muss eigentlich vor allem schön singen. Zu meinen
wichtigsten Partien gehört vielleicht auch noch Pfitzners Palestrina.
Und
Ihre liebsten Lieder?
Das ist sehr schwer
zu entscheiden, aber auf jeden Fall habe ich die Zyklen bevorzugt - Schubert,
Schumann, weniger Brahms.
Kollegen
Ihrer Zunft haben auch das Schreiben entdeckt....
Da brauchen Sie
keine Angst zu haben, ich schreibe keine Zeile mehr. Das Buch, das jetzt
von mir herausgekommen ist, ist ja nur eine Überarbeitung und Erweiterung
einer früheren Edition.
Was
fangen Sie denn nun mit Ihrer ganzen freien Zeit an?
Ach, ich faulenze
doch so gern (lacht). Im Ernst, ich freue mich sehr darauf, nicht mehr unter
ständigem Termindruck zu stehen.
Das
heißt, Sie werden neue Ruhepunkte finden....
Ja, deshalb empfinde
ich bei meinem Abschied auch keine Wehmut. Natürlich ist es schön,
wenn man einen Abend gestalten kann, aber es ist immer mit Anstrengung und
Spannung und auch mit viel Entbehrungen verbunden. Ich brauche nicht dieses
Sich-Darstellen, denn das ist für mich eine Pseudo-Kunst. Ich habe
niemals äußere Mittel benutzt, um etwas herüberzubringen.
Das hat mich an dem Metier Oper immer etwas gestört, obwohl ich oftmals
auch an der Oper großen Spaß hatte.
Gibt
es in Ihrer bilanzierenden Rückschau Dinge, die Sie heute anders machen
würden?
Vom rein Künstlerischen
her denke ich heute, dass ich zu viel gemacht, z.B. zu viel Oper gesungen
habe. Und die musikalische Qualität vieler Opernaufführungen bleibt
weit hinter dem zurück, was die Qualität auf dem Konzertsektor
ausmacht. Einfach, weil viel Repertoire gesungen wird, weil man von Bühne
zu Bühne reist, um in der Karriere voranzukommen. Das hat zwar für
mich funktioniert, aber es war künstlerisch nicht immer befriedigend.
Es war für mich ein Glücksfall, dass ich an einer großen
Bühne - in Dresden -mit kleinen Partien anfangen konnte. Das ist der
bessere Weg als umgekehrt. Junge Sänger heute haben es viel schwerer,
weil die Konkurrenz unter ihnen unheimlich groß ist und die Qualität
der Stimme nicht mehr so im Vordergrund steht. Sondern vielmehr der Typ
und die Frage, wie der Regisseur mit dem Sänger zurechtkommt.
Wenn
Sie noch einmal auf diese Welt kämen, würden Sie auch wieder gern
ein Tenor werden?
Ich glaube schon.
Ich habe mich so dran gewöhnt (lacht).
Wer
waren für Sie die wichtigsten Menschen auf Ihrem künstlerischen
Lebensweg?
Am Anfang war
es Rudolf Mauersberger. Im Privaten natürlich meine Frau, im Künstlerischen
hatte ich später zahlreiche wichtige Partner.Da waren zum Beispiel
die Dirigenten Karl Richter und Wolfgang Sawallisch, die Regisseure Jean-Pierre
Ponelle und Günter Rennert. Und im Nachhinein betrachtet auch der Österreicher
Otmar Suitner, der mich sehr gefördert hat und den Mut besaß,
mich in etwas hineinzuwerfen, wovon ich selbst zunächst nicht überzeugt
war. Zum Beispiel den David in Wagners "Meistersingern" zu singen.
Es ist so wichtig, wenn man weiß, dass der da unten im Graben zu einem
steht. Viele Dirigenten sind heute nur noch auf Durchreise und haben kaum
Zeit, sich wirklich mit den Sängern zu beschäftigen und diese
zu fördern.
Hören
Sie gern CDs?
Nur mit Widerwillen
meine eigenen, weil man eigentlich immer unzufrieden ist. Ich lege mir gern
Sachen auf, die mich musikalisch interessieren:Klaviermusik und Streichquartette,
das ist für mich die schönste Art des Musizierens. Und ich höre
Jazz, im Moment zum Beispiel ganz besonders Diana Krall, deren Feeling für
diese Musik unglaublich ist.
Und
was von Ihnen selbst?
Gern höre
ich mir an, was außerhalb meiner Bühnentätigkeit lag: den
Siegfried und den Mime. Das war etwas, worauf ich ungeheure Lust hatte,
weil es mir andere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete.
Es
gibt eine Schallplatte mit Peter Schreier als Altsolist im Kreuzchor, mögen
Sie diese?
Ja, auch wenn darauf nicht alles perfekt ist. Wenn ich die Aufnahmen heute
höre, stelle ich fest, dass man wohl auch ohne Stimmbildung leben kann.
Wir haben damals unter Mauersberger gesungen, wie uns der Schnabel gewachsen
war. Das war vielleicht auch das Geheimnis von Mauersberger, dass er ein
gutes Händchen hatte für Stimmen und für die Mischung der
Stimmen. Und er hat die Kompositionen den Stimmen, z.B. auch meiner, auf
den Leib geschrieben.
Empfinden
Sie heute noch eine enge Bindung zum Kreuzchor?
Ich gehe ab und
zu zur Vesper. Meine Anhänglichkeit bezieht sich ja auf meine Kruzianerzeit,
meine besten Freunde waren mit mir im Kreuzchor. 2007 übrigens soll
ich den Kreuzchor auf einer Japan-Tournee dirigieren. Das ist natürlich
für mich eine Ehre.
Neues
Deutschland 28.07.2005
Star ohne
Allüren
Der Sänger und Dirigent Peter Schreier wird 70
Vor einiger Zeit war zu lesen, Peter Schreier beabsichtige, Ende dieses
Jahres seine Sängerkarriere zu beenden. Er wolle, dass das Publikum
ihn in stimmlich guter Verfassung in Erinnerung behalte. Ein bedauerlicher
wie begrüßenswerter Entschluss. Ihn live nicht mehr als Evangelist
in den Bach'schen Passionen zu hören, ihn nicht mehr als einzigartigen
Liedgestalter auf dem Podium erleben zu dürfen, darf man schon bedauern.
Andererseits zeugt es von besonderem Verantwortungsgefühl, dass da
einer nicht den Kredit künstlerischer Glanzjahre eitel verspielt.
Wie viele einst große Sängerpersönlichkeiten haben den Zeitpunkt
verpasst, sich rechtzeitig von ihrem Publikum zu verabschieden. Sicher fällt
das auch Peter Schreier nicht leicht. Denn wenn einer bereits als Knabe
zu frühem Ruhm gelangt, und als Erwachsener auf den Bühnen der
Welt zu Hause ist, muss der Gedanke, künftig die Zuneigung des Publikums
nicht mehr unmittelbar zu verspüren, schmerzlich sein. Von der Opernbühne
hatte der Tenor sich ja in den zurückliegenden Jahren bereits unauffällig
zurückgezogen, obwohl er auch hier als Mozart-Sänger Beispielloses
leistete. Besonders durch seine überragende musikalische Gestaltungskraft
sorgte er für singuläre Erlebnisse, auch wenn seine schauspielerischen
Talente den musikalischen nicht gleichrangig waren.
Schreier ist Musiker durch und durch. Das befähigt ihn auch zu besonderen
Leistungen als Dirigent. So ist er denn ein gern gesehener Gast bei internationalen
Orchestern. Das mag ihm den Abschied vom Sängerberuf dann auch erleichtern.
Der am 29. Juli 1935 im sächsischen Gauernitz Geborene hatte das Glück,
in einem musischen Elternhaus aufzuwachsen. (....) Besonders Peter Schreiers
Mitwirkung in der »H-Moll-Messe« ließ ihn zu dem international
wohl berühmtesten Knaben-Alt werden. Wer die Eterna-Schallplattenaufnahme
davon in seinem Hausarchiv hat, darf sich glücklich schätzen.
Trotz dieses frühen Ruhmes hat der Sänger nie den Boden unter
den Füßen verloren. Auch später als Tenorstar bewahrte er
seine Natürlichkeit. Stets ist es ihm ein Bedürfnis geblieben,
im Kontakt mit seinem Publikum zu bleiben. So war er denn auch häufiger
Gast beim »Konzert-Winter auf dem Lande« – einer Veranstaltungs-Reihe
in der DDR, die jenseits der kulturellen Zentren möglichst vielen Menschen
Kunst nahe bringen wollte. Seine Talente hat Schreier als besonderes Geschenk
begriffen, dem er verpflichtet ist. Kunst ist ihm nicht Mittel zur eitlen
Selbstdarstellung, sondern innerstes Anliegen, andere durch ihre Teilnahme
daran reicher werden zu lassen. Das mag auch das Motiv gewesen sein, als
Präsident des Kuratoriums Schauspielhaus Berlin mit seiner internationalen
Reputation sich für ein reiches Musikleben in der DDR einzusetzen,
auch wenn er die oft engen ökonomischen und ideologischen Beschränkungen
nicht zu beseitigen vermochte.
Im musikalischen Leben bildet das Erbe mit Bach, Mozart und Schubert den
künstlerischen Mittelpunkt. Die »Moderne« ist in seinem
Repertoire nur relativ schwach vertreten, aber immerhin hat er mit Liedern
von Prokofjew, Hindemith und Dessau für Aufsehen gesorgt. Das Geheimnis
der Erfolge des Tenors ist sicher zu einem guten Teil darin zu suchen, dass
Peter Schreier nur dass sang, was seiner stimmlichen Eigenart, seinem Naturell
entsprach. Über die Leichtigkeit des Tones, die sichere Führung
der Stimme, die Genauigkeit der Artikulation, die souveräne Phrasierung
ist viel geschrieben worden.
Kalte Virtuosität, reine Stimmartistik, sich selbst genügender
Schöngesang sind ihm ein Groll. Treffend wurde seine Sangeskunst nach
einem Konzert bei den Salzburger Festspielen in der »Presse«
Wien beschrieben: »Vor allem ist es die Kunsthaftigkeit, gleichzeitig
die Natürlichkeit – ein Paradoxon, das sich im Idealfall auflöst
–, mit dem Schreier melodische Bögen und ausdrucksvolle Deklamationen
in einander übergehen lässt.«
Wenn es auch gilt, sich vom Sänger Schreier zu verabschieden, ist die
Gratulation zum 70. jedoch mit dem Wunsch verbunden, er möge uns als
Dirigent noch viele schöne Erlebnisse vermitteln. G.G.
Freie
Presse 27.07.2005
Stimmgewaltiger
Grenzgänger
Kammersänger Peter Schreier wird am Freitag 70 Jahre alt
Dresden. Singen will
der Tenor nicht mehr. Zum letzten Mal werde er am 22. Dezember als Evangelist
im Weihnachtsoratorium in Prag zu hören sein, hat Peter Schreier ein
ums andere Mal verkündet. Ob er sich daran hält? Der gebürtige
Meißener wird am Freitag 70 Jahre alt - und er sagt selbst von sich,
dass er zurzeit «als Sänger in Top-Form» sei.
Musikkritiker bezeichneten den Mann schlicht als die Idealbesetzung für
den Evangelisten in Bachs geistlichen Werken, als großen Liedersänger
und auch als einen der hervorragendsten Mozart-Tenöre, der etwa den
Tamino aus der «Zauberflöte» eben nicht nur «spielt,
sondern eben der Tamino ist», wie ein Rezensent einmal schrieb. (.....)
Der einstiger Vorzeige-Künstler, der vor dem Bundesverdienstkreuz eben
auch schon den Nationalpreis der DDR 1. Klasse verliehen bekam, hat Grenzen
nicht gekannt. Der Versuchung, Ort und Land dauerhaft zu wechseln, ist Schreier
indes nie erlegen, obwohl er dafür genügend Angebote hatte. Er
begründete dies einmal damit, dass er einfach seine Heimat brauchte,
um sein «seelisches Gleichgewicht zu behalten». Seine Bindung
an Dresden zeigt sich auch darin, dass Schreier zur Weihe der wiederaufgebauten
Frauenkirche sowohl im Gottesdienst am 30. Oktober als auch beim Konzert
am 1. November singen wird.
Ab 2006 will er dann nur noch dirigieren. Am Pult tritt der seit 48 Jahren
verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne bereits seit den siebziger
Jahren in Erscheinung. Dass es dazu überhaupt kam, beschreibt Schreier
selbst als puren Zufall: In einem Almanach des Ensembles der Deutschen Staatsoper
Berlin, von der er 1963 mit einem Gastvertrag verpflichtet worden war, habe
er als Hobby neben Fußball - Schreier bolzte schon zu Kruzianer-Zeiten
leidenschaftlich gern und verstand sich auch Jahre später hervorragend
auf das Herunterbeten von Mannschaftsaufstellungen - noch Dirigieren angegeben.
Der Orchestervorstand habe ihn deshalb wenig später darauf angesprochen
und gefragt - und er einfach zugesagt.
In unzähligen Wohnzimmern wird Schreiers Stimme nie verstummen. Dafür
sorgt schon allein eine der mehr als 600 Plattenaufnahmen: Das Album «Peter
Schreier singt Weihnachtslieder» wurde mit rund 1,4 Millionen Exemplaren
zum mit Abstand meistverkauften Tonträger in der Geschichte der DDR
- und es wird von Generation zu Generation weitergehört.
Mitteldeutsche
Zeitung 20.07.2005
Peter Schreier
führt jetzt ein Leben ohne Stress
Sänger feiert am 29. Juli seinen 70. Geburtstag - Opernkarriere
endete vor 5 Jahren

Schreier hat seinen Abschied von den Bühnen der Welt exakt geplant. Mit dem Rentenalter beendete er vor fünf Jahren seine Opernkarriere. «Das ergab sich aus einer Notwendigkeit. Als Opa kann ich keinen jungen Prinzen Tamino verkörpern, auch wenn ich ihn noch singen kann. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit», verwies Schreier auf seine Paraderolle in Mozarts «Zauberflöte. Den letzten Auftritt als Interpret von Liedern und Oratorien wird er am 4. Advent bei Bachs «Weihnachtsoratorium» in Prag absolvieren.
Künftig will sich Schreier nur noch dem Dirigieren widmen. In den vergangenen Jahren hatte er bereits am Pult namhafter Orchester wie der Berliner Philharmoniker, der Staatskapelle Dresden und der Wiener Symphoniker gestanden. «Es gibt Termine bis in das Jahr 2007 hinein, unter anderem in der Dresdner Frauenkirche, in Bologna und Hamburg. In Japan werde ich mit dem Kreuzchor Mozarts «Requiem» aufführen», sagte Schreier: «Ich dirigiere nur noch, um frisch zu bleiben und der Musik weiter verbunden zu sein.»
Gleichwohl ist Schreier ein kritischer Betrachter der aktuellen Musikszene. In der Opernregie hat er in den vergangenen Jahren einen negativen Trend ausgemacht. «Das Regieführen verkommt oft zur Profilierungssucht, wird zu einer Form der Selbstdarstellung.» Obwohl ein Großteil des Publikums das ablehne, würden solche Regisseure von den Medien in den Himmel gehoben. Offenbar gebe es sogar gezielte Provokationen, um auf diese Art «Regisseur des Jahres» zu werden. «Schuberts "Schöne Müllerin"» kann man nicht als Persiflage machen. Das ist nicht Sinn dieser Musik, nannte er ein Beispiel. Es gebe genügend andere Sachen, an denen sich Regisseure austoben könnten. Auch in der Diskussion um Rotstift-Politik im Kulturbetrieb schlägt Schreier kritische Töne an: «Schon in den 70er Jahren wurde klar, dass wir uns den Luxus im Theater auf Dauer nicht leisten können. Oper ist ein opulentes Genre. Dennoch lassen sich viele Dinge einfach gestalten. Da wird mancherorts viel zu viel verschwendet.»
Vorarlberger
Nachrichten (VN) 15.06.2005
Schreiers "Schwanengesang"
Sängerlegende.
Riesenapplaus Montagabend für einen stimmlich bestens disponierten
Peter Schreier mit der "Schönen Müllerin". Schuberts
Liederzyklus hat den Tenor als Markenzeichen ein Leben lang begleitet, weit
über 400 Mal trat er als gefeiterter Müllerbursche in aller Welt
auf. In Schwarzenberg war das nun definitiv das letzte Mal, denn Peter Schreier
beendet heuer, im Jahr seines 70. Geburtstages (am 29. Juli), seine beispiellose
Sängerkarriere.
Zum "VN"-Exklusivgespräch begrüßt er mich herzlich - wir kennen uns seit vielen Jahren
durch Radio- und Fernsehprojekte. Und ist gleich einmal stolz darauf, als
"dienstältester" Schubertiade-Künstler seit dem Gründungsjahr
1976 nur einmal krankheitshalber "gefehlt" zu haben.
Was ihm in all den Jahren imponierte, war die Kontinuität des Festivals,
auch in der Gunst des Publikums: Es waren fast immer dieselben Leute, also
ein fast elitäres Liedpublikum, das einen verstanden hat. "
60 Jahre Sänger.
Das Wort Abschied will Schreier aber nicht gelten lassen: "Das klingt
so nach Sterben, und das Leben geht doch weiter! Aber es sind, wenn ich
meine erste Zeit als Sängerknabe im Dresdner Kreuzchor mitrechne, jetzt
60 Jahre, dass ich singe, und da habe ich doch das Recht darauf, mich etwas
zurückzuziehen."
Freilich, eine "Träne im Knopfloch" wird schon dabei sein,
wenn seine Freunde aus der ganzen Welt am Sonntag zum unwiderruflich letzten
"Schwanengesang" anreisen und ihm sicher einen berührenden
Abschied bereiten werden. Zu allen drei Zyklen hat er diesmal den deutschen
Liedbegleiter Wolfram Rieger ausgewählt - der letzte in einer langen
Reihe prominenter Pianisten, angefangen von Svjatoslav Richter über
Helmut Deutsch, András Schiff: "Dieser Wechsel machte die Sache
stets interessant, jeder Klavierbegleiter brachte neue Impulse, bewahre
mich ertarrter Routine."
Fußballfan.
Was wird Peter Schreier als Neo-Pensionist tun? "Man möchte einfach
einmal frei sein, ohne Druck von Konzertauftritten und Terminen." Und
als eingefleischter Fußballfan wird er die WM 2006 im TV nicht mehr
wie bisher in den Konzertpausen hinter der Bühne anschauen, sonder
gemütlich mit seiner Frau bei sich zuhause.
Frits Jurmann
Mehrere
Zeitungen / Several newspapers 19.05.2005
Peter Schreier
kündigt Karriereende an
Prag. Der deutsche Kammersänger Peter Schreier (69) will zum Jahresende
seine Karriere definitiv beenden. "Ich möchte auf dem Höhepunkt
Schluss machen, damit meine Zuhörer mich in guter Erinnerung behalten",
sagte der am 29. Juli 1935 in Meißen (Sachsen) geborene Tenor am Donnerstag
am Rande des Musikfestivals "Prager Frühling".

thumbnail ![]()
Künftig wolle er nur noch dirigieren, betonte Schreier: "Aber
auch das nicht so lange, bis ich den Stock nur noch zitternd halten kann."
(.......)
Märkische
Oderzeitung 07.05.2005
Peter Schreier
mit Sächsischem Mozartpreis für Lebenswerk geehrt
Chemnitz. Kammersänger Peter Schreier ist am Freitag mit dem Sächsischen
Mozartpreis 2005 ausgezeichnet worden. Er erhält den Preis für
sein Lebenswerk als herausragender Mozart- und Bach- Interpret sowie für
seine Verdienste um die Förderung des künstlerischen Nachwuchses.
"Peter Schreier gehört seit mehreren Jahrzehnten zu den Ausnahmekünstlern,
er hat als Sänger wie Dirigent Maßstäbe gesetzt", sagte
der Dresdner Musikwissenschaftler Hans John in seiner Laudatio.
Schreier dankte in bewegten Worten für die Ehrung: "Ich bin sehr
glücklich über diese Auszeichnung, weil sie mit dem Namen Mozart
verbunden ist." Der Musiker kündigte an, er werde in diesem Jahr
mit dem Singen aufhören. "Ich gehe auf die 70 zu und da ist man
als Sänger nicht mehr auf dem Höhepunkt. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt dafür." Schreier begeht am 29. Juli seinen 70. Geburtstag.
Vor fünf Jahren, zu seinem 65. Geburtstag, hatte er Abschied von der
Opernbühne genommen. Seither tritt er verstärkt als Dirigent auf.
Schreier war als lyrischer Tenor von Dresden über Berlin, New York,
Wien bis Mailand auf den wichtigsten Opernbühnen der Welt gefeiert
worden. Er zählte auch als Interpret von Liedern und Oratorien zu den
Großen seines Fachs.
Schreier hatte in Chemnitz
vor der Preisverleihung das umjubelte Eröffnungskonzert des 14. Sächsischen
Mozartfestes dirigiert. Das Chemnitzer Barockorchester, der Thüringische
Akademische Singkreis und Gesangssolisten führten Georg Friedrich Händels
"Messias" auf. Das Oratorium erklang in der selten gespielten
Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
Der mit 2500 Euro dotierte Sächsische Mozartpreis wird jährlich
von der Sächsischen Mozart-Gesellschaft verliehen. Er ging bisher an
die Sopranistin Jana Büchner, das Ensemble Trio di Clarone mit Klarinettistin
Sabine Meyer und den Pianisten Andreas Staier.
Freie
Presse 06.06.2005
„Die Leute
werden verheizt“
Startenor Peter Schreier über Nachwuchsförderung
Chemnitz. Heute Abend beginnt die 14. Auflage des Sächsischen Mozartfestes. Startenor Peter Schreier, mittlerweile vor allem als Dirigent aktiv, führt beim Eröffnungskonzert in der Chemnitzer Kreuzkirche den Stab. Mit dabei ist unter anderem ein junges Solistenensemble. Und weil Schreier nicht nur als Mozart-Interpret weltweit Karriere machte, sondern auch den Nachwuchs fördert, erhält er nach dem Konzert den Mozartpreis der Sächsischen Mozartgesellschaft. Doch wie tritt man im heutigen Konzertbetrieb in die Fußstapfen eines bekennenden Sachsens, der an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt gastierte? Daniel Gräfe fragte nach.
Freie
Presse: Herr Schreier, Sie bezeichnen sich gerne als „Provinznudel“.
Was bindet Sie eigentlich so sehr an Dresden?
Peter Schreier (lacht): Meine
Jugendzeit, die Landschaft, die Ausbildung im Dresdner Kreuzchor, das Studium,
das erste Engagement an der Semperoper– da kommt vieles zusammen,
was mich gebunden hat. Die Möglichkeiten hier sind für mich entscheidend
gewesen. Und die Dresdner haben eine ungeheure Liebe zur Musik wie überhaupt
zur Kunst. Andere suchen anderswo Anregungen – ich habe sie alle hier
bekommen.
Freie
Presse: Sie selbst versuchen seit etlichen Jahren als Dirigent,
den Nachwuchs zu fördern.
Peter Schreier: Ich will die jungen Leute an Mozart und Bach heranführen und bekannt
machen. Das Angebot an Sängern ist äußerst groß, da
ist es ohnehin schwer, sich durchzusetzen. Außerdem kämpfen viele
Orchester und Theater derzeit ums Überleben.
Freie
Presse: Können Sie da jungen Leuten überhaupt noch zu
einer Gesangskarriere raten?
Schreier: Das ist eine Gewissensfrage.
Wenn ein Sänger Talent und einen großen Ehrgeiz hat, ist es zu
schaffen. Aber sie müssen kämpfen, denn Beziehungen, Lobbys und
Glück geben häufig den Ausschlag. Außerdem muss man sich
heute doch sehr in Szene setzen können. Es gibt einige Sängerinnen,
die ihrer hübschen Visage wegen Karriere machen.
-- „Heute
ist man schnell raus aus dem Geschäft“
Freie Presse: Stört Sie
die zunehmende Vermarktung?
Schreier: Heute wird ja schon ein Sternchen, das sich noch nicht bewährt hat,
zum Star gemacht. Die Leute werden verheizt, denn sie müssen musikalisch
Aufgaben übernehmen, denen sie aber noch nicht gewachsen sind. Trotzdem
setzt sich Talent durch.
Freie
Presse: Glauben Sie wirklich daran?
Schreier: Ja, da bleibe ich optimistisch.
Freie
Presse: Wie war ihr eigener Karrierestart?
Schreier: Meine Karriere ist
ja sehr stark mit den 50er bis 70er Jahren verbunden. Damals hatte mehr
Zeit, mich zu entwickeln, der Druck war geringer. Heute muss man immer dran
bleiben, sonst ist man schnell raus aus dem Geschäft.
Freie
Presse: Das heißt, man muss eine neue CD nachlegen und anschließend
wieder sofort auf Konzerttournee gehen ...
Schreier: … um sich so zu verausgaben. Ein Künstler braucht aber auch Ruhe
und Besonnenheit, um für Neues offen zu sein.
Freie
Presse: Luciano Pavarotti hat sich bis vor kurzem bestens vermarktet.
Als er älter wurde, hat er sich einfach genügend Mitstreiter auf
die Bühne geholt...
Schreier: Ja, aber das gehört für mich zum Showgeschäft und hat mit
Kunst nichts zu tun. Pavarotti hat sicherlich eine schöne Stimme, aber
was künstlerisch heute rüber kommt, ist doch eher lächerlich.
Freie
Presse: Ist Deutschland noch eine Musiknation?
Schreier: Ja, aber wir bewegen uns weg davon. Der Musikunterricht in den Schulen lässt
sehr zu wünschen übrig. Es hängt zu viel von der Privatinitiative
einiger Eltern ab, die Masse geht unter. Außerdem interessieren sich
die Schüler vor allem für Pop und Rock. Es gibt ja im Rundfunk
kaum anderes. Ich sehe ja bei meinen Enkelkindern, dass sie klassische Melodien
nicht mehr interessieren. Berufsmusiker haben wir trotzdem noch mehr als
genug, aber es geht ja um das breite Verständnis für Musik, sonst
stirbt uns ein musikinteressiertes und gebildetes Publikum aus. Das Konzert-
und Opernpublikum ist ja überaltert.
Freie
Presse: Müssten nicht mehr Pop und Jazz Eingang finden in
die Konzerte?
Schreier: Da bin ich skeptisch. Ein verjazzter oder verrockter Bach ist eben kein
Bach. Es auf dieser Linie zu erreichen, halte ich für eine Gefahr.
Vielleicht bin ich da etwas konservativ.
Marktplatz
Oberbayern (Münchner Merkur) 08.04.2005
Russischer Offizier
spielte auf dem Flügel
Peter Schreier weinte
vor dem Soldaten
München. Bayerischer
Kammersänger ist er, als Mozart- und Wagner-Interpret stand er oft
auf der Bühne des Münchner Nationaltheaters. Kürzlich dirigierte
er im Gasteig die Matthäus-Passion, bei der er auch selbst den Evangelisten
sang. Fans von New York über Buenos Aires bis Tokio jubelten ihm zu.
Doch im Grunde seines Herzens ist Peter Schreier (69), wie er's ausdrückt,
eine "Provinznudel" geblieben. Heute wohnt er in Dresden, geboren
ist er in Meißen, seine Kindheit verbrachte er Gauernitz, einem Dorf
zwischen Meißen und Dresden - dort, wo Schreier auch das Kriegsende
erlebte.
"Gar nicht so bewusst" habe er die entscheidenden Tage mitbekommen, sagt er. Der Vater, ein Kantor und Lehrer, kämpfte als Soldat, mit Mutter und Bruder konnte sich der damals Neunjährige "durch unsere landwirtschaftlichen Beziehungen einigermaßen über Wasser halten". Bis eines Tages die Russen übers Feld herannahten: "Ein Offizier kam zu uns in die Wohnung, sah den Flügel und fing an zu spielen", erinnert sich Schreier.
Der Russe winkte den kleinen Peter heran, der prompt zu heulen anfing. "Da hat mich meine Mutter einfach zu ihm auf den Schoß gesetzt. Etwas zu essen wurde uns überlassen. Trotzdem war's eine merkwürdige, makabre Situation: In der Nachbarwohnung wurde, wie ich später erfuhr, gerade die andere Lehrersfrau vergewaltigt."
Viel mehr hat sich Schreier die verheerende Bombardierung Dresdens eingeprägt. "Mit angesengten Haaren, zerfetzten Kleidern und Schubkarren" seien die Menschen aus der Stadt aufs Land geflohen. "Darunter waren zwei Sänger von der Semper-Oper, die bei uns blieben, bis sie mit dem Pferdetreck nach Österreich weiterzogen." Den Angriff selbst habe Schreier mit seinem Bruder auf einem komfortablen Aussichtsplatz erlebt: auf dem Turm der Gauernitzer Schule. "Die Tragweite, die Bedeutung des Ereignisses war uns nicht klar. Wir sahen das mehr als Spektakel und haben gestaunt, wie die Christbäume da vom Himmel kamen und Dresden hell erleuchteten."
Peter Schreier gehörte
später zu den maßgeblichen Prominenten, die sich für den
Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche einsetzten. "Anfangs war ich
noch skeptisch: Muss es ausgerechnet die Frauenkirche sein? Gibt es nicht
viel wichtigere Dinge? Straßen oder soziale Einrichtungen?" Doch
die enorme Dynamik der Spendenaktion habe ihn überzeugt. "Und
heute bin ich sehr, sehr glücklich - und werde selbstverständlich
zur Eröffnung dort singen." M.T.
Münchner
Merkur 23.03.2005
Von Bach kann die Kirche lernen
Zur Matthäus-Passion:
Gespräch mit Peter Schreier
"200 oder 300"
Matthäus-Passionen hat Peter Schreier (69) schon hinter sich, als Sänger,
seit den 80er-Jahren in der Doppelfunktion als dirigierender Evangelist.
So auch an diesem Karfreitag im Gasteig, wenn er das Opus mit dem Münchener
Bach-Chor aufführt (14.30 Uhr, Live-Übertragung auf Bayern 4).
Und damit wohl zum letzten Mal hier zu hören sein wird: Zum Jahresende
will Schreier, einer der größten Bach-, Mozart- und Schubert-Interpreten
unserer Zeit, seine Gesangskarriere beenden.
Wie war Ihre erste
Matthäus-Passion?
Schreier: Da war ich noch
gar nicht im Kreuzchor, sondern durfte dort den Cantus firmus mitsingen
- übrigens in der Dresdner Frauenkirche. Als ich dann 19 war, hat mich
der damalige Kreuzkantor Rudolf Mauersberger eingeladen, den Evangelisten
zu übernehmen. Ohne richtige Ausbildung. Und da bin ich hoffnungslos
eingebrochen. So schlimm, dass nur noch heiße Luft kam. Woraus ich
die richtigen Konsequenzen gezogen habe: Ich begann ein Hochschulstudium.
Die Matthäus-Passion im Konzertsaal: Ist das ein Widerspruch?
Schreier: Nein. Ich finde,
sie gehört allen Leuten, nicht nur den Strenggläubigen. Die Musik
als solche ist Weltliteratur.
Der Evangelist soll, so sagten Sie, ein leidenschaftlicher Teilnehmer
sein. Also ist er Zeuge des damaligen Geschehens? Oder für uns heute
eine Art Prediger?
Schreier: Er
ist beides. Ein Erzähler - und ein Spiritus rector, der dem Publikum
die Geschichte verbildlicht. Also ist er nicht nur ein Betrachtender, sondern
mit großer Emotion dabei. Bach arbeitet ja in den Rezitativen mit
extremen Intervallsprüngen, die können nicht einfach "nur"
gesungen werden.
Und wie schaffen Sie es, sich in jeder neuen Aufführung zu motivieren?
Schreier: Das ist eben das
Geheimnis von Bach. Es gibt keine Aufführung, in der ich nicht inspiriert
wäre. Anders war das in der Oper, etwa in Rossinis "Barbier von
Sevilla". Schon die Ouvertüre konnt' ich nicht mehr hören.
Und wenn ich beim letzten Takt auf die Bühne musste - puh . . . Eigentlich
brauchte ich die Opernbühne nicht, um mich auszudrücken. Deshalb
ist es mir verhältnismäßig leicht gefallen, dort mit 65
aufzuhören.
Hat sich die Stellung
einer Passions-Aufführung in den letzten Jahrzehnten gewandelt?
Schreier: Der heutige
Hörer ist ja durch viel mehr Medien beeinflusst und geschult. Er hat
eine größere Erwartungshaltung - und ein größeres
musikalisches Verständnis. Die Passion wird nicht nur als Gottesdienst
anbetend wahrgenommen, sondern eben auch rein künstlerisch. Bach muss
demnach dem Publikum in einer sehr lebendigen, sehr artikulierten Form dargeboten
werden.
Heißt das im Umkehrschluss, dass Bach immer "actionreicher"
interpretiert werden muss?
Schreier: Möglicherweise.
Aber da hat ja die historisierende Aufführungspraxis etwas Positives
ausgelöst. Auch wenn ich kein so großer Freund davon bin.
Also hat die Matthäus-Passion längst die Funktion eines Ersatzgottesdienstes.
Schreier: Für mich schon.
Wobei ich sogar das "Ersatz-" streichen würde.
Aber paradox ist es schon: Die Kirchen werden immer leerer, und die
Matthäus-Passion ist stets bestens verkauft.
Schreier: Und
was sagt uns das? Wenn sich nur die Kirche so erneuern würde wie die
Sichtweise auf Bachs Musik! Wobei bei mir eine Passions-Aufführung
nie aus rein religiöser Motivation erfolgt. Das hat auch viel mit der
Tradition der Heimat zu tun. Mit dem Kopf und mit dem Herzen.
Was muss denn ein junger Tenor, der sich an den Evangelisten wagt, mitbringen?
Schreier: Eine gute sprachliche
Artikulationsgabe. Das Bewusstsein für den musikalischen und textlichen
Hintergrund. Natürlich eine angenehme Stimme. Aber er soll sich bitte
keine Schönsingerei vornehmen.
Haben es Tenöre schwer, die unter Ihnen singen? Die müssen
ja vor Respekt erstarren.
Schreier: Das
glaub' ich nicht. Wer bei mir singt, ist eigentlich nicht gehemmt. Im Gegenteil,
ich ermuntere die Solisten ja ständig.
Welchen Stellenwert
hat bei Ihnen das Unterrichten?
Schreier: Da
treffen Sie einen wunden Punkt. Ich habe keine Geduld, das ist ein großer
Nachteil. Ab und zu gebe ich Meisterklassen, Interpretationskurse. Mit unterschiedlichem
Erfolg.
"Nicht mal
im Badezimmer", so meinten Sie, wollen Sie ab Januar singen. Das glaubt
Ihnen keiner.
Schreier: Naja, vielleicht
im kleinen Kreise, Privatkonzerte (lacht). Wenn ich mich stimmlich gut fühle,
rufe ich einfach alle an und sage: Kommt schnell vorbei!
Was stört Sie
eigentlich am Musikmarkt?
Schreier: Diese ganze Hochschießerei
von Künstlern durch Medien und PR-Kampagnen. Zeit für eine klug
geplante Karriere bleibt kaum noch. Und manchmal werden Leute zu Stars gemacht,
die nun wirklich keine sind.
Und was machen Sie
am für Sie gesangslosen Karfreitag 2006?
Schreier: Hm. Weiß ich
gar nicht. Vielleicht bleibe ich einfach mal zu Hause. Wäre für
mich doch auch eine neue Erfahrung, oder? M.T.
![]()
AERA,
Wochenzeitschrift von Asahi Shimbun 14.03.2005
“Japaner
und Deutsche sind gewissermaßen ähnlich”
Zuhörer beider Völker
suchen tiefe Geistigkeit und Bedeutungen an den Werken von Bach oder Schubert.
In beiden Ländern gibt es ruhigen und warmen Applaus.

thumbnail ![]()
Tenorsänger Peter Schreier: - Geboren am 29. Juli 1935 in Meißen, während der Teilung Deutschlands im DDR-Gebiet - 1943: Eintritt in den Kreuzchor in Dresden. 2 Jahre später Aufnahme in Internat des Kreuzchors. - 1958: Einschreibung an der Musikuniversität in Dresden. Hauptfach Gesang, Nebenfach Dirigieren. - 1959: Vertrag mit Staatsoper Dresden, Debüt als Gefangener in “Fidelio”. - 1963: Vertrag als Solist mit Staatsoper Berlin. - 1970: Debüt als Dirigent an der Staatsoper Berlin. - 1974: Erste Reise nach Japan. Seitdem öftere Konzerte in Japan. 1990: Abschied von der Oper, in der viel Kraft verlangt wird. Der letzte Opernauftritt war in der “Zauberflöte”, Staatsoper Berlin. - Januar 2005: Singt „Winterreise“ und „Matthäuspassion“ in Japan. - November 2005: Abschiedkonzerte (O-wakare-Konsaato) in Japan vorgesehen. |
Vor 31 Jahren, als Peter Schreier zum ersten Mal nach Japan kam, kam er von San Francisco. Er kam um 16 Uhr in Haneda, Tokyo, an, fuhr vom Flughafen zum Konzerthalle „Hibiya Kôkaido“ und sang dort „Die schöne Müllerin“ von Schubert. Er lächelt und sagt: „Das kann man nur, wenn man jung ist.“
Damals konnte er 100 Konzerte im Jahr absolviert, aber jetzt nun mehr die Hälfte davon. Er sätzt seine Arbeit als Dirgent fort, aber er entschied, dass er in diesem Jahr, in dem er 70 Jahre alt wird, mit dem Gesang aufhört. „Der Stimmband eines Sängers ist wie die Muskeln eines Sportlers. Wie viele Hitze und Spannkraft erzeugt wird, liegt an der körperlichen und seelischen Kraft. Bevor man mir nachsagt: 'er hat doch früher schöner gesungen’, möchte ich, dass man meine Stimme in guter Erinnerung behält.“
Er stammt aus der ehemaligen DDR. Gefolgt dem Wunsch seiner Eltern, fing er 10-jährig Internatleben beim renommierten Dresdner Kreuzchor an. Strenge Regeln, Menschenbeziehungen in der engen Gesellschaft, jeden-Tag-neue-Lieder-Lernen für Freitagsliturgie.... Er dachte auch an Weglaufen. „Aber das Leben dort ist alles, was mich heute stützt. Gute Pädagogen und gute Lernsystem - alte DDR war, wenn man nur diesen Punkt betrachtet, gut.“ Heute noch, so Schreier, könne er 350 bis 400 Lieder seiner Repertoire innerhalb eines Tages vorbereiten. „Das kommt von Training in den jungen Jahren und Gedächtnis.“ Auch nachdem er als Solist debütierte und mit bekannten Dirigenten wie Karajan oder Böhm zusammenarbeitete: „in allen Gebieten half mir jene Selbstkontrolle, den ich während meiner Internatzeit angeeignete.“ Das gilt für seinen gefühlskontrollierten Ausdruck bei Evangelist in „Matthäuspassion“, dafür er bekannt ist, und auch bei den deutschen Liedern.
Anfang dieses Jahres sang Schreier „Winterreise“ von Schubert. Falsetto der Willenlosigkeit und Kopfstimme mit schwachem Hoffnungsschimmer kreuzen sich einander und lassen so die Zerbrechlichkeit des Junglings Herzen sowie Konflikte aufkommen. Seine Natürlichkeit, die dem Zuhörer die sorgfältig durchdachte Konstruktion nicht ahnen läßt... diese erinnerte mich an die höchste Meisterleistung, von der Zeami (Nohmeister) in „Fûshi-kaden“ meint: „Nichts tun, dennoch bleibt die Blume.“
Aber ab dem nächsten Jahr: „Gartenarbeit, Lesen, Musik nach der „Moderne“ genießen, zu der ich keine Beziehung hatte... Ich werde mein Privatleben genießen, das ich 60 Jahre lang aufhob. Singen? Nicht einmal im Badezimmer werde ich mehr singen.“
Redaktion: Juri (dschuri)
Saitô
Ins deutsch übertragen: Akemi Steinböck - am 16. März
2005
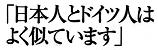 |
Ratgeber 12.2004
Peter Schreier
Er gilt als einer der größten Tenöre
der Welt, sich selbst bezechnet er als "Provinznudel". Eine Begegnung
mit der Bescheidenheit.
Professor Peter Schreier,
69, heitmatverliebter Sachse mit Wohnsitz in Dresden, einer der größten
Tenöre unserer Zeit. In fast allen wichtigen Opernhäusern der
Welt ist er aufgetreten, als noch "Osten" war und ebenso danach:
in der Mailänder Scala, der New Yorker Metropolitan, in den Staatsopern
von Wien, Hamburg und Berlin, in Bayreuth natürlich - und 25 Jahre
lang bei den Salzburger Festspielen. Seit 1986 ist Schreier Ehrenmitglied
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. So wie vor ihm Beethoven, Schubert
und Bruckner. Und gleich dreimal wurde er zum Kammersänger ernannt:
in der DDR, in Bayern und in Österreich.
 thumbnails |
 |
Sich groß zu vermarkten, wie es beispielsweise sein italienischer Kollege Pavarotti so meisterhaft beherrscht, war Schreiers Ding nie. Stattdessen nimmt er den "Siemens-Preis" entgegen, so etwas wie den Nobelpreis für einen Musiker. 1988 war das. Die Liste der frühreren Preisträger liest sich wie ein "Who is who" der klassischen Musik: Yehudi Menuhin, Herbert von Karajan, Mstislav Rostropowitsch und Leonard Bernstein sind darunter. Doch wie aud keinen anderen passt der Text, der Schreiers Urkunde ziert: "MIt diesem Preis wird ein Sänger geehrt, der, fern vom Starrummel, sein überragendes Können stets in de Dienst der interpretierten Werke stellt."
Ein solches Leben verlangt ungeheure Kräfte ab. "Man wird ständig an seinen besten Leistungen gemessen", sagt Schreier: "Ich stand immer unter Spannung und Erfolgszwang". Die Kosten des Erfolgs musste auch die Familie tragen. Zu Beginn seiner Laufbahn durfte der DDR-Bürger nur solo ins Ausland reisen. "Nach meinem Debüt in New York saß ich allein im Hotelzimmer. Es war Weihnachten, und ich habe geheult, weil meine Frau nicht mitdurfte", erinnert sich Schreier. Er hatte Glück, die Ehe hat alle Zerreißproben bestanden - seit 47 Jahren. Heute reisen die zwei viel zusammen. Die beiden Kinder konnte Schreier zwar manchmal mit ins Ausland nehmen. Gemeinsame Zeit war trotzdem Luxus. "Ihr hatten schöne Vergünstigungen, konntet reisen", rechtfertigt er sich ihnen gegenüber heute. "Aber du warst nicht da", halten sie ihm entgegen. Man sieht sich selten, auch wie vor, die Söhne sind weit weg gezogen. "Ab und zu sehen wir mal ein Enkelkind, aber wenn die kommen wollen, muss ein Termin gemacht werden", erzählt Schreier über sein striktes Zeitmanagement.
Zwar tritt der Sänger seit ein paar Jahren beruflich kürzer, aber "kürzer" ist relativ. Schreier beschäftigt noch immer eine Sekretärin und gibt jede Woche ein Konzert, mal mit dem Dresdner Streichquartett, mal mit dem finnischen "Peter Schreier Chor", den er gerade in Helsinki besucht hat. Dazu jede Menge Proben. Etwa morgen Abend. "Ich würde mir lieber das Fußball-Länderspiel ansehen", bedauert er. Aber heute, heute Abend ist definitiv fürs Fußball reserviert. In seinem Arbeitszimmer steht ein TV-Gerät mit Großbildschirm. Daneben ein Flügel und volle Regale: Musikliteratur, Partituren, vor allem Mozart und Bach. Schreier wühlt sich durch seinen überladenen Schreibtisch. Ein paar Noten müssen noch verschickt werden, der Kurier wird gleich kommen. "Wenn ich nur nicht so ein Chaot wäre!", seufzt er.
Ein Wand im Arbeitszimmer beansprucht der CD-Schrank. Eine Sonderanfertigung mit extra viel Platz", schmunzelt Schreier. 3000 bis 4000 CDs dürften es schon sein. Auch etwas aus Pop und Rock darunter? Energisch schüttelt er den Kopf. Moderne Unterhaltungsmusik ist ihm einfach zu einfallslos. Aber halt, eine Platte ist doch dabei: Sinatra-Klassiker, gesungen von Robbie Williams. Am 29. Juli nächsten Jahres [2005] wird Peter Schreier 70. Danach, so hat er sich vorgenommen, wird er von der Bühne abtreten. Nur als Dirigenten wird ihn das Publikum dann noch erleben. Wenn man älter werde, lasse die Spannkraft der Stimmbänder nach und auch die körperliche Konstitution, sagt der Sänger. Für Schreier ist klar: "Ich möchte nicht den Punkt erreichen, wo man sagt: Ach, hätte er mal aufgehört."
Man merkt dem Bühnenmenschen
an, wie schwer ihm dennoch der Abschied fällt. Und ein sanfter Ausstieg,
einer auf Raten, funktioniert im Gesangsfach nicht. "Wenn ich raste,
roste ich. Das ist so mit der Stimme", weiß Schreier, der auffallend
jung wirkt. Stattliche Statur, wache Augen, das Stehkragenhemd, künstlerschwarz,
ein wenig extravagant. (........)
Es ist wenige Wochen nach Kriegsende, Dresden ein Trümmerhaufen, als
sich der Kantorsohn durch die Aufnahemprüfung des renommierten Kreuzchors
singt: "Wem Gott will rechte Gunst erweisen." Während seine
Eltern daheim im Meißener Umland blieben, findet der Knirps von nicht
mal zehn Jahren in einem Dresdner Keller ein neues Zuhause - mehr Provisorium
als Internat. In dieser Not entstehen Freundschaften, die bis heute Bestanden
haben. "Einsam habe ich mich in meinem Leben nie gefühlt",
erzählt Schreier. Das ist ein Geschenk, und für einen Menschen
mit seinem Lebenslauf ein ganz besonderes. Neun Jahre blieb er im Kreuzchor.
Es folgten private Gesangsstunden, bis er Gesang und Dirigieren an der Hochschule
Dresden studierte. 1962 dann der erste große Erfolg: Der Opernsänger
brilliert in Mozarts "Entführung aus dem Serail". Ein Jahr
später engagiert ihn die Staatsoper in Ost-Berlin - Schreiers Weltkarriere
beginnt. Neben seinem Stimmtalent und dem extremen Arbeitswillen hilft ihm
eine dritte, ganz besondere Fähigkeit: "Ich hatte eine Natur,
mich körperlich und geistig auf den Punkt zu bringen."
Entspannung findet er
im Grünen, beim Radfahren und als Hobbygärtner in seinem Gewächshaus.
Neben seinem Haus an den Dresdner Elbhängen gibt es noch ein Refugium
auf dem Land, wo Schreier sein Glück darin findet, "Beim Aufwachen
die Vögel piepsen zu hören". Nichts konnte ihn, den Heimatverwurzelten,
dauerhaft von hier vertreiben, kein DDR-Regime und kein Bühnen-Engagement.
"Die Heimat stand für mich immer im Mittelpunkt", sagte Peter
Schreier. "Ich bin 'ne Provinznudel."