• Jazz
• Letzte Prüfung
•
Irgendwann
bin ich kein junger Prinz mehr
• Mehr
als ein gehacktes Salatblatt
• Musik
"für die Insel"
• Dirigieren
•
Innige
Beziehung zur "Schöpfung"
•
So
perfekt bin ich nicht
•
"Wer
Mozart singen kann, wird auch Wagner singen können"
| 2017-2019 | 2013-2016 | 2010-2012 | 2007 - 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | < 2002 |
Dresdner
Neuesten Nachrichten 13.12.2001
Innige Beziehung zur "Schöpfung"
Peter Schreier dirigiert in der Semperoper erstmals Ballettaufführungen

Am Sonntag kommt an der Sächsischen Staatsoper Dresden in der Choreographie von Uwe Scholz "Die Schöpfung" von Joseph Haydn zur Premiere. Damit übernimmt das Ballett Dresden ein wichtiges Werk des bekannten Choreographen, das er 1985 mit dem Zürcher Ballett herausbrachte und vor einem Jahrzehnt zum Auftakt seiner Ära als Ballettchef der Leipziger Oper in einer Neufassung auch an diesem Hause inszenierte. Die musikalische Leitung der vorerst fünf Aufführungen mit dem Ballett Dresden in der Semperoper - weitere sind für 2003 vorgesehen - liegt in den Händen von Peter Schreier. Als Dirigent so außerordentlich erfolgreich wie als Sänger dirigiert er damit erstmals auch Ballettaufführungen. Gabriele Gorgas sprach mit ihm über dieses Novum in seinem bewegten künstlerischen Leben
Frage: Kam dieses Angebot für Sie überraschend?
Peter
Schreier: Da ein vorgesehenes anderes Ballett von Uwe Scholz nicht zu realisieren
war, wurde ich gefragt, ob ich "Die Schöpfung" übernehmen
könnte. Wenn man solch ein Angebot mit der Dresdner Staatskapelle und
dem Staatsopernchor bekommt, dann ist das schon eine reizvolle Aufgabe.
Dennoch habe ich sie nicht ganz unbesehen angenommen. Und mir zunächst
die Aufzeichnung einer Leipziger Vorstellung von 1998 angeschaut. Um sicher
zu sein, dass ich diese Inszenierung auch vertreten kann. Es gibt ja gewisse
Einschränkungen für mich; ich kann in einer Ballettaufführung
nicht so musizieren, wie ich das im Konzertsaal tun würde, muss gewisse
Tempi für die schon vorhandene Choreographie einfach annehmen. Da lässt
sich kaum noch etwas ändern. Einige Kompromisse gibt es natürlich,
aber diese werden von Uwe Scholz akzeptiert. Man ist musikalisch nicht ganz
so frei wie in einem Konzert. Das ist schon ein gewisses Korsett. Als ich
die Aufnahme sah, war ich von der Ästhetik, der Leistung der Tänzer
sehr beeindruckt. Sicherlich wäre es der Idealfall gewesen, ich hätte
ein Band mit meinen musikalischen Vorstellungen machen können und Uwe
Scholz hätte dazu choreographiert. Aber nun ist es anders gekommen,
und da muss man sich auch anpassen können.
Haben Sie eine besondere
Bindung zu Haydns "Schöpfung"?
Oh ja. Ich habe
sie seit meinen jungen Jahren oft gesungen, unter den verschiedensten Dirigenten,
angefangen mit Karajan, dann Kempe, Bernstein, Böhm... Die Tenoraufgabe
ist sehr, sehr schön, und ich fühle eine innige Beziehung zu diesem
Werk. Ich habe es auch schon einige Male dirigiert, darunter in Wien, Salzburg,
vor fünf Jahren auch mit der Staatskapelle hier in Dresden.
Weckt ihr erstes
Dirigat einer Ballettaufführung die Lust auf weitere Aufgaben dieser
Art?
Da wollen wir
doch erstmal abwarten. Ich sehe das gar nicht so als etwas völlig anderes.
Natürlich muss es Absprachen geben und musikalische Übereinstimmung.
Zumindest bemühe ich mich, den Tempovorstellungen des Choreographen
nachzukommen. Und erfreue mich sehr an der Musikalität einiger Tänzer.
Außerdem käme bei solchen Dirigaten eh nur in Frage, was zu meinem
Repertoire gehört, Bach oder Mozart beispielsweise. Doch es ist nicht
so, dass ich nun unbedingt weiter Ballett dirigieren muss.
Waren Sie auch schon
als Sänger in eine Ballettaufführung einbezogen?
Nicht unmittelbar
in die Vorstellung, aber ich habe in der Aufzeichnung der Matthäuspassion
für die Hamburger Inszenierung von John Neumeier gesungen. Ich sollte
damals live auftreten, doch ich wehrte mich dagegen. Für die letzte
Vorstellung in Hamburg hat mich Neumeier umgestimmt, und ich war hingerissen,
schaute von der Kirchenempore so fasziniert zu, dass ich fast das Singen
vergaß. Mein Argument, was soll die Stimme, wenn keiner hinhört,
alle nur auf die szenische Aktion achten, musste ich korrigieren. Andererseits
bestätigte es sich bei einer Aufführung in Salzburg auf dem Domplatz.
Da kam die Matthäuspassion irgendwo von weit hinten herübergeweht.
Alles schwatzte und flanierte. Und ich war froh, dass es nur eine Bandaufzeichnung
war.
Was sind Ihre nächsten
Pläne?
Es gibt noch einige
Konzerte und Aufführungen in Berlin, Hamburg und Dresden, bevor ich
im Januar für vier Wochen nach Los Angeles gehe und die musikalische
Leitung einer Inszenierung von Achim Freyer zur h-Moll-Messe übernehme.
Placido Domingo hat mich dazu eingeladen. Im März werde ich an der
Helsinki Oper eine szenische Aufführung der Johannespassion dirigieren.
Sächsische
Zeitung 12.05.2001
So
perfekt bin ich nicht

Lust
auf Pensionärsruhe? Projekte an unscheinbaren oder akustisch ungünstigen
Orten? Warum hat das Interesse am Lied so abgenommen?
Über András Schiff. Und, ist Peter Schreier wirklich so diszipliniert
und ausgeglichen?
Text
>>
Jazz
Gibt es noch etwas, bei
dem Peter Schreier 30 Zentimeter abhebt?
Jazz. Gerade sagte Masur in New York zu mir, du kannst heute Abend in
ein Jazz-Konzert gehen, der Wynton
Marsalis spielt mit seiner Big Band. Es war umwerfend!
Peter
Schreier in einem interview mit Neues
Deutschland, 10./11.06.2000.
Berliner Morgenpost 07.06.2000
Letzte
Prüfung
«Irgendwann geht
die Motivation verloren»: Der Tenor Peter Schreier singt morgen zum
letzten Mal den Tamino an der Staatsoper - Als Sänger verabschiedet er
sich endgültig aus der Opernwelt, als Dirigent bleibt er erhalten.
Auf dem Gendarmenmarkt wird gerade lautstark geprobt: Wagners 'Meistersinger', dritter Aufzug. Mit dem Open-air-Projekt hat Peter Schreier nichts zu tun. Aber er habe auf dem Weg in seine Wohnung mitgesungen, erzählt der berühmte Tenor. Er ist gut drauf. Trotz einer stressigen Woche. Gerade hat er eine Liedermatinee an der Staatsoper Unter den Linden gegeben. Am Sonnabend dirigiert er dort Mozarts «Zauberflöte». Zuvor, am Donnerstag, singt er zum letzten Mal den Tamino. Peter Schreier, der im Juli 65 Jahre alt wird, zieht sich offiziell von der Opernbühne zurück.
- Herr Schreier, Sänger
kündigen gerne ihren Rückzug von der Bühne an. Manche sogar
gleich mehrfach.
Peter
Schreier: Ja, ja. Ich kenne da auch eine Sängerin, die mindestens zehnmal mit der
«Winterreise» ihr Ausscheiden angekündigt hat. Aber man wird
geradezu in solche Ankündigungen gedrängt. Ich hätte das jetzt
alles gar nicht so theatralisch gemacht. Ich hatte nur gesagt, die letzte
Vorstellung muss irgendwann im Juni stattfinden, denn am 31. Juli beende ich
mein Vertragsverhältnis mit der Staatsoper. Und das nehme ich als Anlass,
gleich ganz mit der Oper aufzuhören. Also auch nirgend wo anders mehr
zu singen. Ich hatte nicht angekündigt, gar nicht mehr zu singen. In
der Matinee am Sonntag taten die Leute, als wäre es mein letztes Mal.
Jedenfalls ließ der Applaus darauf schließen. Aber da haben sie
sich zu früh gefreut.
- Es ist jetzt also
das letzte Mal Oper?
Schreier:
Definitiv.
Ich habe 41 Jahre lang Oper gesungen. Irgendwann ist der Schlusspunkt
erreicht. Man will kein junger Prinz mehr auf der Bühne sein. Und
irgendwo muss man sich im zunehmenden Alter auch einschränken. Außerdem
habe ich viele Liederabende und Dirigate zugesagt, bin mindestens für
die nächsten zwei Jahre ausgelastet. Insofern fällt es mir nicht
schwer, jetzt mit der Oper Schluss zu machen.
- Sie haben auch immer
gesagt, dass Sie die Oper nicht so gerne machen?
Schreier:
Ja. Aber es
sollte nicht so klingen, als hätte ich es nie gerne gemacht. Es ist
nur so, dass die Oper bei mir an der dritten Stelle lag. Erst nach Konzert
und Liederabend. Johann Sebastian Bach liegt mir einfach mehr am Herzen.
Ich habe in meiner Laufbahn die Oper schon sehr ernst genommen. Aber wenn
man den «Barbier von Sevilla» 150 Mal und noch mehr gesungen
hat, dann geht die Motivation verloren. Merkwürdigerweise war es
bei Mozart nicht so. Der Mozart ist musikalisch doch eine andere Dimension.
- Tamino und seine
Prüfungen? Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn man jenseits
der 60 den jungen Prinzen singt?
Schreier: Das hängt davon ab, welche Sänger man um sich hat. Wenn man
eine 25jährige Pamina hat, dann denkt man schon daran, dass sie eigentlich
mein Enkelkind sein könnte. Vor zwei Jahren sang ich hier einen Tamino.
Meine Frau saß im ersten Rang neben einer Mutter mit ihrem Kind.
Das vielleicht siebenjährige Kind fragte zwischendurch seine Mami,
ob der Tamino so alt sein müsse? Natürlich nicht. Es gibt genügend
junge Sänger. Und das Publikum ist stärker vom Medium Fernsehen
geprägt. Heute wird zuerst nach Typ und Alter besetzt. Das muss man
akzeptieren.
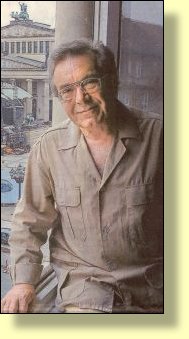
- Vom Fenster Ihrer
Berliner Wohnung aus können Sie direkt aufs Schauspielhaus schauen.
Inwieweit waren Sie, der dem Kuratorium bis zur Wende vorstand, eigentlich
am Wiederaufbau des Konzerthauses beteiligt?
Schreier: In den Wiederaufbau war ich nicht involviert. Gut. Kurz vor der Eröffnung
1984 haben wir mit dem Architekten ein paar Durchgänge gemacht. Oder
haben über die Akustik gesprochen. Aber meine Beteiligung ist ganz
anders zustande gekommen. Erich Honecker wollte unbedingt, dass dieses
neue Haus von einem prominenten Künstler geleitet wird. Ich habe
damals abgelehnt, weil ich dann mit dem Singen hätte aufhören
müssen. Daraufhin haben sie mich ziemlich bearbeitet. Jemand empfahl
mir dann, ein Kuratorium zu gründen. Als Präsident war ich letztlich
nur eine Repräsentationsfigur.
- Kultur in der DDR:
Inmitten der sozialistischen Planwirtschaft gab es seltsamerweise auch
kapitalistische Inseln. So konnte sich etwa Stardirigent Kurt Masur mit
seinem Leipziger Gewandhausorchester quer durch die Welt
verkaufen . . .
Schreier: Das Prinzip Angebot und Nachfrage hat immer schon in der künstlerischen
Arbeit funktioniert. Auch im Sozialismus. Man hat sich nach besten Möglichkeiten
verkauft. Wer gefragt war, konnte auch eine gute Gage aushandeln. Und
andere Konditionen.
- Sie hatten auch
einen Platz auf der Insel?
Schreier: Ich gehörte schon zu denen, die ihre Forderungen stellen konnten.
- Hauptsächlich waren Sie in Österreich . . .
Schreier: Ach, ich war in der ganzen Welt. In Amerika, in Italien, Spanien, England.
In Japan. Ich war Mitglied der Staatsoper und Ehrenmitglied des Musikvereins
in Wien. Das sind schon die Gipfel der künstlerischen Anerkennung.
- Dann kam die Wende?
Schreier: Für mich hat sich damit
praktisch nichts geändert. Ich habe meine Verpflichtungen weiterhin
gehabt. Am Tag des Mauerfalls, von dem ich gar nicht soviel mitbekommen
habe, habe ich in Berlin-Schöneweide eine wichtige Plattenaufnahme
gemacht. Für Philips.
Es hatte sich so gar
nichts verändert?
Schreier: Vielleicht doch. Das Verhältnis
zu meinen Freunden ist freier geworden. Wenn man als Künstler reisen
konnte, hatte man natürlich viele Eindrücke. Zuhause wollte
man davon aber nicht zu viel erzählen. Weil man nicht prahlen wollte.
- Die Staatsoper Unter
den Linden, an der Sie seit 1963 singen, ist Ihr Stammhaus. Welche ist
die schönste und welche die schrecklichste Erinnerung?
Schreier: Ich hatte viele schöne
Erinnerungen. Beispielsweise erinnere ich mich an «Cosi fan tutte»
im Apollo-Saal gerne. Das schrecklichste Erlebnis fand auch im Apollo-Saal
statt. Ich war stockheiser. Aber Intendant Hans Pischner bat mich, wenigstens
sprechend aufzutreten. Natürlich versuchte ich zu singen. Drückte
drauf. Hinterher musste ich drei Wochen pausieren.
- Hat der Künstler
Peter Schreier noch unerfüllte Träume?
Schreier: Ich habe keine. Aber ich möchte einigermaßen gesund bleiben.
Ich habe immerhin ein stressiges Leben geführt. Ich war einer von
denen, die immer zuviel gemacht haben. 40 Jahre haben mich ganz schön
geschlaucht.
Die
Welt 08.06.2000
Irgendwann
bin ich kein junger Prinz mehr
Der
Tenor Peter Schreier feitert heute in der Staatsoper seinen Bühnenabschied
Peter
Schreier hat nie in einem Fussballstadion gesungen. Weil er mit Bach, Mozart
oder Schubert "da nicht weit gekommen wäre". Und weil seine
Weltkarriere begann, als die Klassik noch nicht von Eventmanagern und Image-Profilern
verscherbelt wurde. Der 64-jährige Tenor ist ein Ausnahmekünstler,
der mit seinen feinnervigen, intelligenten Interpretationen vor allem des
Mozart- und Liedrepertoires Maßstäbe setzte. Seiner Grenzen war
sich Schreier dabei immer bewusst: Er blieb bei lyrischen Partien, mied Rollen
des schwereren Fachs - "sonst könnte ich jetzt nicht mehr so singen".
Als Tamino in der "Zauberflöte" verabschiedet er sich heute
Abend an der Staatsoper Unter den Linden von der Opernbühne. Mit Peter
Schreier sprach Jochen Breiholz.
DIE WELT: Erfüllt Sie Ihr Abschied mit Traurigkeit?
Peter
Schreier:
Nein, überhaupt nicht. Ich freu' mich drauf. Es
ist doch ganz natürlich. Wenn ich auf der Bühne einen jungen Prinzen
spiele, wirkt das irgendwann nicht mehr glaubwürdig, sondern komisch.
Schließlich bekommt man jeden Tag im Fernsehen vorgesetzt, wie Typen
in bestimmtem Alter auszusehen haben. Außerdem werde ich weiterhin Liederabende
geben und dirigieren. Eigentlich bin ich ein ziemlich fauler Mensch. Weil
aber andere mich ständig pushen, komme ich nicht in den Genuss der Faulheit.
Ich sehne mich nach mehr Ruhe.
DIE WELT:
Könnten Sie sich vorstellen, Gesang zu unterrichten?
Schreier:
Nicht wirklich. Von den Meisterklassen, die ich ab und
zu gebe, bin ich eher enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass diejenigen,
die wirklich etwas von mir lernen könnten und die gesangstechnischen
Voraussetzungen dazu besitzen, nicht kommen - weil die sich nichts mehr sagen
lassen wollen. Die haben heute alle ein Image zu verteidigen.
DIE WELT:
In den letzten Jahren sind Sie verstärkt als Dirigent aufgetreten. Ein
Ersatz für den Gesang?
Schreier:
Nein, etwas völlig anderes: der Wille, die Gesamtheit
des Musizierens im Zusammenklang mit den Musikern zu beeinflussen.
DIE WELT:
Verstehen Sie Dirigenten besser, seit Sie selbst auf dem Podium stehen?
Schreier:
Ich stand eigentlich meistens auf der Seite der Dirigenten,
weil ich meine, dass viele Sänger dazu neigen, sich gesanglich zu viele
Freiheiten zu nehmen - auf Kosten der musikalischen Genauigkeit. Diesen Individualismus
der Sänger, den man auch Schlamperei nennen könnte, lehne ich ab...
DIE WELT:
Neben Bach und Mozart haben Sie regelmäßig Wagner gesungen - David
in den "Meistersingern", Loge im "Rheingold" ....
Schreier:
Und das ist interessanterweise gar nicht so weit von
Bach entfernt. Karajan sagte mir nach einer Matthäus-Passion, ich müsse
Loge singen. Als ich's dann in Salzburg gemacht habe, hat das Publikum getobt.
Und ich hab' mir gedacht, was ich all die Jahre mit Mozart falsch gemacht
habe - dass ich da nie solch' einen Applaus bekommen habe. Aber Wagner ist
eben spektakulärer.
DIE WELT:
Sie waren - neben Theo Adam - der international berühmteste Künstler
der DDR. Die Mauer gab es für Sie nicht. Was hat Ihnen die Wende bedeutet?
Schreier:
Künstlerisch gar nichts. Aber privat. Ich habe
mich für alle die Freunde, Kollegen und Bekannten gefreut, die jetzt
reisen konnten. Freiheit war schließlich an beruflichen Erfolg gebunden.
Jedesmal, wenn ich aus den USA oder aus Italien kam, durfte ich nicht sagen,
wie schön es dort war, ums nicht noch schwerer zu machen.
DIE WELT:
Gibt es einen unerfüllten Traum?
Schreier:
Nie in Londons Covent Garden aufgetreten zu sein. Und
nie den Aschenbach in Brittens "Tod in Venedig" gesungen zu haben.
Sonst nichts.

Berliner Morgenpost
11.06.2000
Mehr
als ein gehacktes Salatblatt
Dankbarer
Esser und bewunderungswürdiger Evangelist: Erinnerungen an den Tenor
Peter Schreier. Von Klaus Geitel.
Das Leben spielt nachweislich mit uns Fußball. Man ahnt nichts Böses,
und plötzlich ist es um einen geschehen. Ich wachte eines Morgens auf, ich
war gerade 50 geworden und wusste, ich müsste sofort beginnen, Blumen
zu lieben, sonst wäre es dafür ein für allemal zu spät.
Dann wurde ich mit einem Schlage kochgeil. Schlanker kann man das leider gar
nicht bezeichnen. Ich lag auf dem Sofa und studierte Kochbücher, die
ich in großen Mengen anschaffte. Das Beste bis heute ist, auch wenn
Alfred Biolek weint, das Rezeptbuch des Koch-Wettbewerbs, den die Wochenzeitung
Die Zeit einst veranstaltet hat. Ich kochte Zeile für Zeile alle diese
Mundwässerer nach. Ich kochte für Gäste, vorzüglich für
psychisch oder physisch zwangsläufig Unbehauste: die entzückend
herzliche, natürliche Milva, die lustige Agnes Baltsa, die gefährliche
Eliette de Karajan - und unter anderen für Peter Schreier. Ich hoffe
nur, dass er jetzt, wo er von der Bühne Abschied genommen hat, gelegentlich
wieder die Zeit findet, bei mir zu essen. Natürlich ist es albern, für
Damen wie Milva oder Agnes Baltsa zu kochen. Sie essen sowieso nur ein gehacktes
Salatblatt, wenn es nicht zu groß oder zu fett ausfällt. Peter
Schreier dagegen war, was jeder weiß, nicht nur ein großer Sänger;
er war auch ein dankbarer Esser. Zu allererst lernte ich ihn natürlich
als Sänger bewundern, und diese Bewunderung baute sich über die
Jahrzehnte hin auf, bis in die jüngste Zeit, da er mit einer Expressivität
sondergleichen den Evangelisten in Bachs Matthäus-Passion sang, buchstäblich
als sei er dabei gewesen, damals, in Jerusalem.
In Schreiers
Konzerte zu gehen, war so risikolos wie der allsonnabendliche Gang zum Lotto,
dort die sechs Richtigen zu ertippen. Gewiss - beim Lotto tippte man mitunter
daneben, bei Schreier nie. Ich entsinne mich dankbar der Wahnsinnsreise zur
Eröffnung der Semperoper in Dresden im eiskalten Februar 1985, in der,
klimatisch durchaus angemessen, Peter Schreier zum ersten Mal in seinem Leben
Schuberts «Winterreise» sang. Am Klavier: Swiatoslaw Richter.
Das Konzert begann erst spät am Abend. Zuvor hatte man ausdauernd eine
Ballett-Uraufführung absitzen müssen. Ich durchsaß sie geduldig,
um meines Freundes Udo Zimmermann großartige Komposition zu hören.
Aber ganz schön anstrengend war es auch. Danach nun noch die «Winterreise»
mir aufzuladen? Ich beschloss, die Ohren wenigstens ein bisschen in diese
«Winterreise» hineinzuspitzen. Ich blieb kleben. Ich war gefangen.
Gott sei Dank hat die Schallplatte diesen großen Abend für Zeit
und Ewigkeit festgehalten.
Für
Schreier war es bei allem Weltruhm oft kompliziert. Nie konnte er mit der
ganzen Familie auf Gastspieltour in den Westen reisen. Immer musste jemand
als Geisel zurückbleiben. Als nach Jahrzehnten endlich alle vereint ein
Ausreisevisum erhielten, kehrte prompt Jung-Schreier nicht mehr mit den Eltern
nach Hause zurück. Dann fiel die Mauer. Im Salzburger Großen Festspielhaus
bei der Trauerfeier für Karajan, auf der ich kurz sprechen sollte, zupfte
mich plötzlich Peter Schreier am Ärmel. Ich solle um Gottes Willen
nicht glauben, was zu lesen gestanden hätte: Man habe ihm als «Westgewinnler»
daheim die Autoreifen durchgeschnitten, die Wagenfenster eingeschlagen. Alles
erstunken und erlogen. Der Stunk ist verweht, die Lügen dazu. Peter Schreier
sieht sich in Ost und West zu Recht für seine Lebensleistung aufs herzlichste
bedankt und gefeiert. Er lebe hoch!
Peter Ruzicka (Herausgeber/editor):
Musik
"für die Insel" - was Prominente mit in die Abgeschiedenheit
nehmen
Peter Schreier:
(........) Sicher
käme für mich nur Bachs Mätthäus-Passion in Frage.
Da ich aber als voreingenommener Evangelisten-Interpret begreiflicherweise
ungern dazu Stellung nehme, habe ich ein Werk der Kammermusik ausgewählt.
Franz Schuberts C-Dur-Quintett D 956 op. posth. 163 in einer 1952 eingespielten Aufnahme mit Isaac Stern, Pablo Casals und Paul Tortelier als nahmhafteste Protagonisten.
Ein Quintett, in dem Schubert genial die Geheimnisse des Jenseits verkündet.
Keine Aufnahme anderer Musiker klingt eindringlicher, spricht aus dem verborgensten
Herzen dieser fünf Streicher. Für mich wird so deutlich Schuberts
Übergang ins Unbekannte, Zukünftige, wie bei allen "letzten
Werken" von ihm. (.......)
Atlantis
- Schott, Band 8364, 1997
![]()
Journal
der Bayerischen Staatsoper
1989/'90-10
Dirigieren
(..............) Wird ihm nun das Dirigieren die physische Lust am Singern ersetzen? Gesund
scheint es ja zu sein, die meisten Dirigenten werden alt und bleiben fit.
Derlei Frivolitäten begegnet Schreier nun doch mit seinen eigentlichen
Motiven.
Schreier:
Was mir wirklich interessiert, ist die Arbeit am musikalischen
Ausdruck, und ich möchte endlich mal die Musik, die ich unter so vielen
Dirigenten gesungen habe, nach eigenen Vorstellungen realisieren. Die Zeiten
sind ja leider vorbei, wo ein Fritz Busch ein Jahr lang mit Erna Berger die
Gilda studiert hat. Heute arbeiten Dirigenten kaum noch mit den Sängern
am musikalischen Ausdruck sondern engagieren, wer abliefert, was gewünscht
wird. Selten feilt jemand am musikalischen Ausdruck, während die Regie
mit grossem Einsatz um szenische Lösungen bemüht. Ich bewundere
junge Sänger, die szenisch alles mitmachen, und ich glaube nicht, dass
ich in ihrem Alter dazu so bereit gewesen wäre; aber musikalisch werden
sie nicht in gleicher Weise gefordert.
.......... Die Aufführungspraxis historischer Opern ist nicht selten
Gegenstand missionarischen Eifers, dem Schreier mit der eklektischen Distanz
des Praktikers gegenübersteht. Ihm ist ein Punkt wichtig, der
auch Harnoncourt am Herzen liegt und vorher schon Cavalli, Monteverdi, Bach,
Telemann und manchen anderen: die Musik als Klangrede. "Es wurde immer
wieder, besonders im musikalischen Barock von etwa 1600 bis in die letzten
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts, gepredigt, dass Musik ein Sprache in Tönen
sei, dass es darin um Dialog, um dramatische Auseinandersetzung gehe."
Dieser Satz stammt von Harnoncourt, aber könnte genausogut von Schreier
sein.
Schreier:
In den
Proben geht es darum, möglichst viel Durchsichtigkeit und Plastizität
zu erreichen. Die Sänger sollen die Musik, ihre Rhetorik sprechen lassen.
Ein Sänger muss den Ausdruck den eine Figur verlangt nicht nur gestisch
sondern in erster Linie stimmlich herstellen können. Dazu muss er alles
einsetzen was ihm zur Verfügung steht: Dynamik, Phrasierung, Artikulation,
Stimmfarbe usw. Man darf eine Wendung wie "la morte" oder "qual
furore" nicht einfach schön und rund singen, sondern muss ihr den
nötigen stimmlichen Ausdruck verleihen. Die Sänger werden heute
in erster Linie angehalten Stimme zu zeigen und haben kaum einen Nerv dafür
wo man Akzente setzt oder Phrase leicht nimmt. Nur so kann aber Spannung beim
Zuhörer entstehen. Ich möchte ein wache, lebendige Interpretation,
nicht schöne, gleichförmige und auf die Dauer langweilige Töne.
Sonst plage ich mich mit dem Orchester ganz umsonst. Aber das ist sehr schwer
für Sänger die gewohnt sind Töne zu produzieren. Töne,
Töne, und mich anschauen wie das Kaninchen die Schlange wenn ich sie
um stimmlichen Ausdruck bitte. Statt die Figur singend darzustellen, weichen
sie auf Gesten und Gänge aus - und da sind sie einfach einfallsreich.
Nicht selten aber geht der stimmliche Ausdruck in eine andere Richting als
die szenische Regie. Ich weiss, dass den Stimmfetischisten der reine Wohllaut
genügt, aber ich kann nun einmal mit Gesang nichts anfangen wenn er mir
nichts mitteilt.
Eigentlich
stehen Sie mit ihrem Ideal einen natürlichen Phrasierung, die den Duktus
der Alltagssprache in den Gesang hineinnehmt, den Theoretikern der barocken
Oper sehr nahe.
Schreier:
Ja sicherlich;
aber so natürlich waren Starsänger wie der Ettore oder die Bernasconi
wohl auch wieder nicht wenn man die Koloraturen ansieht die uns die herausgeber
der Neuen Mozart-Ausgabe anbieten.
Wielleicht
waren die Verzierungen doch nicht so unnatürlich wenn man sie mit den
Komplimenten vergleicht die Mozart in seinen Briefen an die Familie gedrechselt
hat - die uns heute auch nicht im Traum einfallen würden. Aber wir sind
schon mitten in einer Diskussion über historische Aufführungspraxis
- wie ist hier Ihre Position?
Schreier:
Ich bin
natürlich geprägt von meiner konservativen Erziehung in Dresden,
dem glatten Bach-Verständnis des 19. Jahrhunderts und sein "Rühr-mich-nicht-an"-Effekten,
über die ich längst hinausgewachsen bin. Ich halte die Auseinandersetzung
um historische Instrumenten für hilfreich, soweit sie uns Hinweise für
die Interpretation gibt, zur Klangfarbe, Phrasierung, Artikulation etc. Aber
warum sollen sich Instrumenten nicht weiterentwickeln? Ich finde eine moderne
Oboe viel klangschöner als den engen, näselnden Klang der barocken
Holzbläser. Ich wünsche mir auch kein Beethovenkonzert auf dem Hammerklavier.
Harnoncourts Arbeit hat mich sehr beeindruck und sicher auch beeinflusst.
Er ist kompromisslos, ein Fanatiker, aber auch er hat den Reiz moderner Instrumente
entdeckt, und als ich mit ihm in Wien den Lucio Silla gesungen habe,
da hat er losgelegt, wie entfesselt. Das Schöne an unserer Kunst ist
doch, dass jede persönliche Aussage ihre Berechtigung hat.
![]()
OPER heute,
Ein Almanach der Musikbühne.
Henschel Verlag, Berlin DDR
1984
"Wer Mozart singen kann, wird auch Wagner
singen können"
>> Text